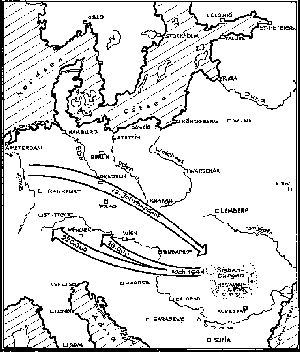Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen
Von Dr. Konrad Gündisch (Oldenburg)
English
Version
|
Kurzbeschreibung Siebenbürgen gehörte im Laufe seiner Geschichte
unterschiedlichen Staaten an: in der Antike dem Daker-, dann dem Römischen
Reich, im Mittelalter dem Königreich Ungarn, in der Neuzeit der Habsburger
Monarchie und seit 1918 Rumänien.
Eines der hier ansässigen
Völker sind die "Siebenbürger Sachsen", die vor ca. 850 Jahren ins
Land gerufen, einen vom ungarischen König verbrieften Staat im ungarischen
Staat schufen.
Lebten 1930 noch ca. 250.000 von ihnen in Rumänien, so
sind es heute nur noch etwa 20.000, da die meisten während der
kommunistischen Diktatur nach Deutschland aussiedelten.
Sie können die gedruckte Version von
"Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen"  online
bestellen! online
bestellen!
Taschenbuch - 304 Seiten (1998)
Langen-Müller, München.; ISBN: 3784426859 |
Inhalt:
1. Das Umfeld: Land und Leute
1.1. Geographische Gegebenheiten
Im Karten- oder Satellitenbild des südöstlichen Europa hebt
sich Siebenbürgen als eine deutlich umrissene geographische Einheit ab:
Ein mit einer Festung vergleichbares, von den Ost- und Südkarpaten sowie
den Siebenbürgischen Westgebirgen wallartig umschlossenes Bergland, das
Siebenbürgische Becken, gegliedert von drei die Donau speisenden
Flüssen (Mieresch, Alt, Somesch) und ihren Nebenflüssen.
Der Bogen der Karpaten stellt einerseits, über die Wald- und die
Westkarpaten (mit Beskiden und Tatra) - die Verbindung zu den Alpen
Mitteleuropas her, bildet aber auch - über die "Porta Orientalis"
(Temesch-Cerna-Furche) - den Übergang zum Balkangebirge
Südosteuropas. Zugleich wird das Gebiet durch die Ostkarpaten von den
Schwarzmeerniederungen und den eurasiatischen Steppengebieten, durch die
Südkarpaten vom Rumänischen Tiefland und durch die
Siebenbürgischen Westgebirge vom Großen Ungarischen Tiefland
abgegrenzt. Die Karpaten sind damit nicht nur Abgrenzungen von geographischen
Landschaften, sie trennen - und verbinden zugleich - jene Regionen, die man
ganz allgemein als Ostmittel-, Südost- und Osteuropa bezeichnet, und deren
geschichtliche und kulturelle Entwicklung sehr unterschiedlich verlaufen ist.
Die Ostkarpaten, deren höchster Gipfel der Pietrosul Rodnei (2303
m) ist, lassen sich in drei parallel verlaufende Gebirgszüge unterteilen:
einen westlichen, vulkanischen Ursprungs (mit dem Oa_-, Gutâi-, _ible_-,
Kelemen-, Görgény-, Hargitta-Gebirge), einen kristallinen Hauptzug
(Marmarosch-, Rodnaer, Borgoer Gebirge) und einen östlichen und
südlichen (vom Csík-Gebirge bis zum Hohenstein und Schuler). Tiefe
Einsattelungen und sich anschließende Flußtäler bilden
Pässe (Tihu_a/Borgo, Oituz, Predeal/Prahova), die einen relativ leichten
Übergang über die Gebirge ermöglichen und über welche
wichtige Verkehrswege führen. Die Ostkarpaten sind zugleich eine
Klimascheide zwischen der atlantischen, der kontinentalen und der baltischen
Provinz.
Die Südkarpaten, mit dem Moldoveanul (2544 m) als höchstem
Gipfel, bilden einen recht einheitlichen kristallinen Gebirgszug, der vom
Törzburger, vom Roter-Turm- und vom Meri_or-Lainici-Paß in die
Massive Butschetsch mit Königstein, Fogarascher mit Cozia, Paring mit
Zibins- und Mühlbacher Gebirge und Godeanu mit Retezatgebirge gegliedert
werden. Die Höhe und die vorhandenen Gletscherspuren (Kare, Moränen,
Seen) der Fogarascher und des Retezat rechtfertigen deren Bezeichnung als
"Transsylvanische Alpen".
Die Siebenbürgischen Westgebirge erstrecken sich vom Mieresch bis
zum Somesch und trennen Siebenbürgen von der Ungarischen Tiefebene. Ihr
zentraler Teil, in dem sich auch die höchste Erhebung, die Curcub_ta (1849
m), befindet, besteht aus kristallinem Schiefer und Granit. Von großer
wirtschaftlicher Bedeutung ist seit altersher ihr südöstlicher Teil
vulkanischen Ursprungs, das Siebenbürgische Erzgebirge, mit den reichen
Edel- und Buntemtallvorkommen im sogenannten Goldenen Viereck zwischen
Offenburg, Kleinschlatten, S_c_râmb und Caraci. Die stark gegliederten,
hügeligen und meist weniger als 1000 m hohen Westgebirge sind heute auch
wegen ihrer schönen Karstformationen (Höhlen, Klammen) ein gern
besuchtes Touristenziel.
Die Karpaten sind bewaldet. Ungeachtet der Himmelsrichtung, aus der man
sich Siebenbürgen nähert, das Land ist von Wäldern umgeben, es
ist jenseits der Wälder (lateinisch: trans silva) gelegen. Die
Wälder der umgebenden Gebirge haben dem Land den lateinischen, ungarischen
und rumänischen Namen gegeben: Transsylvania, Erdély, Ardeal.
Namensschöpfer war wohl die königliche ungarische Kanzlei.
Den Übergang zwischen den Karpaten und dem Siebenbürgischen
Hochland bildet ein Kranz von Randsenken, darunter die Oderhellener, die
Fogarascher, die Zibins- und die Großpolder Senke. In einigen dieser
Senken sowie im Somesch-Hochland lagern große Salzvorkommen, die vor
allem bei Salzdorf, Salzmarkt, Thorenburg, Salzburg und Praid seit
Jahrtausenden abgebaut werden. Da Salz in der Ungarischen Tiefebene und im
östlichen Teil der Balkanhalbinsel fehlt, waren seine
siebenbürgischen Fundstätten bereits in vorgeschichtlicher Zeit sehr
begehrt.
Den zentralen Teil des Landes bildet das Siebenbürgische Hochland,
mit Hügeln und Bergen zwischen 300 und 800 m Höhe.
| "Im Osten des österreichischen Kaiserstaates
erhebt sich aus der ungarischen Tiefebene ein freundliches Hochland, gering an
Größe, doch reich an Schönheiten und Schätzen der Natur.
Sein Flächenraum beträgt wenig mehr als 1100 Geviertmeilen. Im
Anschluß an Ungarns nördlichen Bergwall umgeben es von allen Seiten
mächtige Gebirgketten, die Karpaten. Weithin ins Land hinein, siehst Du
die Felsenkuppen und Zinnen 7000 Fuß hoch und drüber, den
größten Theil des Jahres mit blendendem Schnee bedeckt, in die
blauen Lüfte ragen. Nur wenige Pässe öffnen sie, gegen Mittag in
das Tiefland der untern Donau, gegen Morgen zu den weiten Slavenebenen
Rußlands,also, daß der Herr selber das Land auf die Gränze
abendländisch-europäischer Bildung hingestellt hat zu einer starken
Wehr ... Von den hohen Gränzgebirgen ausgehend durchziehen meist
waldgekrönte Bergreihen das Land nach allen Richtungen. Das Land birgt in
überraschender Fülle Salz und kostbare Erze jeder Art, von dem Eisen
womit man das Leben schirmt, bis zu dem Gold, das es verdirbt. Zahllose
Heilquellen entströmen dem Schooße der Erde; Bäche und
Flüsse verschönern und bewässern überall das Land. An
sonnigen Berghalden glüht die Rebe und blüht der edle Obstbaum; in
den Thälern wogt das Waizenfeld; Wildbrät durchstreift die
Wälder; an zahmen Hausthieren ist nirgends Mangel. Das ist das Land
Siebenbürgen, und wo zum Glück seiner Bewohner Etwas fehlt, da
tragen diese meist selber die Schuld."
G. D. Teutsch: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 1.
Auflage, Kronstadt 1858, S. 3-4 (Hervorhebungen von Teutsch). |
Geformt und geprägt ist die Bodengestalt Siebenbürgens auch
von den Gewässern. Die Flüsse des Landes münden alle, direkt
oder indirekt, in die Donau, die vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer wie
eine "Landstraße, die Völker verbindet, ... als sine qua non
Europas. Flüssiger Code der kulturellen Vielfarbigkeit. Schlagader des
Kontinents. Geschichtsfluß. Zeitfluß. Kulturfluß. Fessel, die
Völker verbindet" - wie der ungarische Schriftsteller Péter
Esterházy schreibt Fußnote1.
Der längste Fluß Siebenbürgens, der Mieresch (Marosch,
776 km), entspringt in den Ostkarpaten, durchfließt
Mittelsiebenbürgen von Ost nach West, nimmt südlich von Thorenburg
den aus den Westgebirgen zufließenden Ariesch (Goldfluß), bei
Blasendorf die Große und die Kleine Kokel und bei Karlsburg den
Mühlbach auf, verläßt Siebenbürgen in einem Durchbruchstal
zwischen den Südkarpaten und den Siebenbürgischen Westgebirgen und
mündet schließlich bei Makó (Ungarn) in die Theiß, den
Nebenfluß der Donau.
Der Mieresch gliedert Siebenbürgen in einen nördlichen - mit
dem Somesch-Hochland, dem Nösnerland, der Siebenbürgischen Heide und
dem Reener Ländchen - und in einen südlichen Teil, mit Kokel-,
Harbach-, Hamlescher und Zekesch-Hochland, die meist nach Flüssen benannt
und von Höhenzügen getrennt werden. Vor allem der Innerkokler
Höhenzug (Zwischenkokelgebiet) eignet sich für den Weinbau, sein
westlicher Teil wird daher auch Weinland genannt. Zudem sind die
Erdgasvorkommen in diesem Raum heute von großer wirtschaftlicher
Bedeutung. Im Siebenbürgischen Hochland sind außerdem der Unterwald
(um Mühlbach), das Hatzeger Land, das Alte Land (um Hermannstadt), das
Fogarascher Land und das Haferland (um Reps) als geographische Einheiten zu
unterscheiden. Schließlich sind die großen innerkarpatischen Senken
zu nennen: das Burzenland (nördlich von Kronstadt, im Karpatenbogen)
sowie, am Fuße der Ostkarpaten, die Drei Stühle (um St. Georgen),
die Csík und Gyergyó.
Die Quelle des Alt (699 km) liegt ebenfalls in den Ostkarpaten; er
durchfließt Südsiebenbürgen, u. a. das Kronstädter Becken
(Burzenland) und die Fogarascher Senke (Altland), nimmt, außer den
zahlreichen sauberen Gebirgsbächen aus den Südkarpaten, den Harbach
und den Zibin auf, verläßt Siebenbürgen durch den
Roten-Turm-Paß und mündet bei Turnu M_gurele in der Walachei direkt
in die Donau.
Der Somesch (Samosch, 345 km) sammelt die Gewässer
Nordsiebenbürgens und führt sie der Theiß zu. Der Große
Somesch (119 km) und sein wichtigster Nebenfluß, der Schogener Bach mit
der Bistritz, entspringen in den Ostkarpaten. Er vereinigt sich bei Deesch mit
dem Kleinen Somesch (166 km), der aus den Siebenbürgischen Westgebirgen
durch die Siebenbürgische Heide zufließt.
Siebenbürgen kann also als eine eigenständige geographische
Einheit im Karpaten-Donau-Raum bezeichnet werden, durch die Karpaten und die
Donau dem Abendland wie dem Morgenland gleichermaßen verbunden, als eine
von der Natur geschaffene Festung, die sich allerdings - dank der von Mieresch
und Somesch gegrabenen Tore und dank der niedrigeren Wälle der Westgebirge
- naturgegeben stärker zum Westen hin öffnet, wohin auch die
wichtigsten Verkehrswege führen.
Das Klima ist gemäßigt kontinental, mit kalten Wintern,
milden Frühlingen, warmen Sommern und dem Schönwetter im
"Siebenbürgischen Herbst". Es gedeihen hier etwa 2500 Pflanzenarten, die
der mitteleuropäischen Floraregion zuzuordnen sind, 68 davon wachsen nur
noch in Siebenbürgen (Königsteinnelke, Siebenbürgischer
Steinbrech u. a.); etwa 40 % des Landes sind von Wäldern bedeckt. Fisch-
und Wildreichtum zeichnet die Fauna aus. Ackerbau kann in den
Flußtälern und in weiten Teilen des Hochlandes betrieben werden, in
den Bergen wurde und wird Vieh gezüchtet.
1.2. Bevölkerung und frühe Geschichte
Fruchtbares Acker- und Weideland, reiche Bodenschätze (u. a. Salz,
Edel- und Buntmetalle), nicht zuletzt eine günstige geographische Lage am
Schnittpunkt west-östlicher und nord-südlicher Verkehrswege, bieten
günstige Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung.
Geographische Lage und natürlicher Reichtum bedingen aber auch eine
bewegte politische Geschichte. Durch die Tore der Karpatenwälle -
über die Gebirgspässe und durch die Täler des Somesch, des
Mieresch und des Alt zogen immer wieder andere Völker mit ihren Kulturen
auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten. Siebenbürgen erlebte keine
Geschichtsperiode, in der in diesem Land eine kulturelle oder ethnische Einheit
herrschte.
1.2.1. Vor- und Frühgeschichte
Siebenbürgen war bereits in der sogenannten vorgeschichtlichen
Zeit, über die keine schriftliche Nachrichten vorliegen, besiedelt.
Archäologische Funde in Höhlen der Brooser Berge und am
Bodsau-Paß - vor allem grobbehauene Steingeräte und Knochenreste -
belegen, daß hier schon in der Altsteinzeit Menschen wohnten, die sich
vorwiegend von Jagd und Fischfang ernährten. Nach der Rückbildung der
Karpatengletscher wurde in der mittleren Steinzeit langsam auch das
Siebenbürgische Hochland auf Flußterassen und an Seen besiedelt. Man
ging zu Viehzucht und Getreideanbau über, wurde seßhaft, verzichtete
jedoch nicht auf Jagd und Fischfang. Diese protomeditterane Bevölkerung
schuf die recht einheitliche Star_evo-Kreisch-Kultur.
In der Jungsteinzeit, nach einer weitgehenden Erwärmung des Klimas,
drangen neue Völker nach Siebenbürgen ein, deren Werkzeuge nun
geschliffen wurden: Von der Balkanhalbinsel kamen über das Banat, entlang
des Mieresch, die Träger der Vin_a-Turda_-Kultur (Ritz-, später
bemalte Keramik), aus der Moldau rückte das Volk der Linienbandkeramiker
und der Cucuteni-Kultur (Höhepunkt der bemalten Keramik) über die
Ostkarpaten vor. Aus der rumänischen Tiefebene kamen die Schöpfer der
Glina-Kultur durch das Burzenland nach Südsiebenbürgen, wo ihre
Spuren als Schnekenbergkultur bezeichnet werden. Diese Menschen lebten auf
durch Terassen gesicherten Höhensiedlungen. Neben Viehzucht und Jagd
lieferte der Ackerbau (weit verbreitet war der Dinkel) die nötige Nahrung.
Salz- und Goldabbau in dieser Zeit sind archäologisch nachweisbar.
Während der Kupferzeit begann die Indoeuropäisierung der
Bevölkerung: Die bronzezeitliche Wietenberg-Kultur ist bereits der
großen Familie der Thraker zuzuordnen, die Anfang des 2. Jahrtausends v.
Chr. auf die Balkanhalbinsel vorgedrungen sind. Die neuen indogermanischen
Wietenberg-Bewohner beschäftigten sich mit dem Gold- und Kupferabbau und
mit der Herstellung und Verarbeitung der Bronze. Sie waren vor allem Schmiede
und Händler; die Nahrungsmittel erwarben sie durch Tausch. Damals
bestanden, wohl wegen der siebenbürgischen Gold- und Salzvorkommen, enge
Beziehungen zum mykenischen Kulturkreis, die auch eine Datierung dieser Kultur
in das 17.- 13.Jahrhundert v. Chr. ermöglichen.
Ende des 14. Jahrhunderts v. Chr. verbreiteten sich von Süden und
Westen her die sog. Hügelgräber; ihre Kultur ist durch Funde in der
Umgebung von Hermannstadt und in der Siebenbürgischen Heide belegt. Die
Wietenberg-Menschen zogen sich in die Berge sowie nach Norden, an den Somesch,
in die Marmarosch und in die Waldkarpaten zurück. Beide Gruppen fielen zu
Beginn der späten Bronzezeit einem Hirtenvolk zum Opfer, das aus den
östlichen Steppen eingefallen war, wohl altiranisch sprach und in
Siebenbürgen die Noua-Kultur schuf.
Bereits um das Jahr 1000 v. Chr. kamen neue Eroberer, das Volk der
Gáva-Kultur, das sich mit den Einheimischen vermischte. Die
Gáva-Menschen wohnten in befestigten Siedlungen, ihr Ackerbau hatte aber
geringere Bedeutung, intensiver betrieben sie die Jagd und das Bronzehandwerk.
Charakteristisch ist ihre innen rote, außen schwarzglänzende
Buckelkeramik. Sie sind mit den Dakern und Geten eng verwandt, die der
indogermanischen Familie der Thraker angehören.
In der Eisenzeit fand, etwa zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. die
ethnische und räumliche Trennung der indogermanischen Völker in
diesem Raum statt. Erstmals wird nun der Name eines in Siebenbürgen
lebenden Volkes historisch überliefert. Herodot berichtet über die am
Mieresch lebenden Agathyrsen, die sich um 513 v. Chr. dem Kampf des
Perserkönigs Dareios gegen die Skythen angeschlossen haben. Der
griechische Geschichtsschreiber hebt ihren Goldschmuck hervor und die Tatsache,
daß sie in Frauengemeinschaften - wohl in Gruppenehen oder
Vielmännerei - lebten. Er erwähnt auch Spargapeithes, einen ihrer
wohl um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. herrschenden Könige. Die
Agathyrsen belieferten die Nachbargebiete mit Metallarbeiten (Spiegel,
Köcher u. a.). Zuletzt wird dieses Volk im 4. Jahrhundert v. Chr. von
Aristoteles erwähnt, der es rühmt, weil es seine Gesetze streng
achtet. Außer den Agathyrsen sind im 3. Jahrhundert v. Chr. noch die
dakischen Kotiner namentlich bekannt, über deren Eisenerzförderung
Tacitus berichtet.
1.2.2. Daker und Römer
In der späten Eisenzeit (Laténe-Zeit), im 4. und 3.
Jahrhundert v. Chr., werden vor allem in griechischen Quellen die Geten
erwähnt, die Herodot als die "tapfersten und gerechtesten unter den
Thrakern" bezeichnet hat. Unter ihrem Herrscher Dromichaites entwickelten
sie sich in der heutigen Walachei zu einem Machtfaktor, der, verbündet mit
den Skythen, um 290 v. Chr. ein makedonisch-griechisches Heer aufgerieben hat.
Die in Siebenbürgen lebenden Nord-Thraker treten vor allem dank der
Römer in das Licht der schriftlichen Überlieferung. Sie werden in den
römischen Geschichtsquellen Daker genannt.
Die Daker hatten zur Abwehr gegen die Kelten im 3.-1. Jahrhundert v.
Chr. den Burgenbau mit Wällen und Steinmauern entwickelt. Unter König
Burebista, der im 1. Jahrhundert v. Chr. fast vier Jahrzehnte lang geherrscht
hat, erreichte die Verteidigungstechnik und Kriegskunst der Daker einen
Entwicklungsstand, der für das nunmehr bis an die Donau vorgerückte
und damit benachbarte Römische Reich zur Gefahr wurde. Burebista war es
gelungen, die dakischen Stämme nördlich der Donau zu vereinigen und
ein Reich zu zimmern, das sich von den Waldkarpaten bis zum Schwarzen Meer
ausdehnte. Dem Herrscher zur Seite stand ein über "fast königliche
Macht" verfügender Oberpriester, ein Hinweis auf eine im Dakerreich
sich durchsetzende einheitliche Religion, mit einem zentralen Heiligtum in den
Brooser Bergen, das zugleich Sitz des Herrschers gewesen sein mag und durch
mehrere Vorburgen verteidigt werden konnte. Neben Ackerbau und Viehzucht wurden
Bergbau, Gewerbe und Handel betrieben, die Gesellschaft war in soziale
Schichten gegliedert.
Caesars Plan, die Gefahr, die von Dakien ausging, zu beseitigen, wurde
nach seiner Ermordung nicht mehr ausgeführt. Im selben Jahr (44 v. Chr.)
wurde allerdings auch Burebista ermordet, sein Reich zerfiel. Das Kernland
Siebenbürgen konnten die Nachfolger allerdings halten. Unter Dezebal
(87-106 n. Chr.) erstarkte das Dakerreich wieder. Kurz nach seinem
Regierungsantritt besiegte er ein römisches Heer, unterlag allerdings bald
darauf bei Tapae (88 n. Chr.). Den danach mit Rom ausgehandelten Frieden nutzte
Dezebal, um das Burgensystem zu auszubauen und das Heer zu reorganisieren. Ohne
das Bündnis mit den Römern zu gefährden, dehnte er sein Reich
bis zur Theiß und an den Dnjestr aus.
Kaiser Trajan erkannte jedoch das Gefahrenpotential, das dieser
politisch, wirtschaftlich und militärisch erstarkte Nachbar bedeutete und
sicher bildete der Goldreichtum des Landes einen weiteren Anreiz, es in Besitz
zu nehmen. Nach einem ersten gewaltigen Anlauf (101-102) wurden die Daker zwar
besiegt, jedoch nicht endgültig unterworfen. Erst nach dem Bau einer
Donaubrücke bei Drobeta (Turnu Severin) - dem Werk des
griechisch-römischen Baumeisters Appollodorus von Damaskus - wurde das
Land in den Jahren 105-106 systematisch erobert und die Hauptstadt
Sarmizegetusa eingenommen. Dezebal stürzte sich in sein Schwert, um der
demütigen Gefangennahme zu entkommen.
Der Sieg und die Unterwerfung Dakiens wurden in Rom überschwenglich
gefeiert, eine Siegessäule, auf der die wichtigsten Momente des Krieges
reliefartig festgehalten sind, erinnert bis heute an Trajans Erfolg. Dakien
wurde zur römischen Provinz.
In einer gewaltigen Kraftanstrengung wurde das eroberte Gebiet in
relativ kurzer Zeit militärisch gesichert und wirtschaftlich integriert:
Legionen und Hilfstruppen wurden hier stationiert, Militärlager
(castra) errichtet, der Limes gebaut. Um den Nachschub zu
gewährleisten legten die Römer ein hervorragendes Straßennetz
an. Ulpia Traiana Sarmizegetusa wurde zur Provinzhauptstadt, Apulum zum
militärischen Zentrum, weitere Städte, darunter die Munizipien Napoca
und Potaissa, als Wirtschafts- und Verwaltungsmittelpunkte gegründet.
Veteranen, Handwerker, Bergleute, Händler wurden "ex toto orbe
Romano", vor allem von der Balkanhalbinsel und aus Kleinasien, angesiedelt,
oft durch Versprechungen angelockt. Mit den dringend benötigten Bergleuten
wurden regelrechte Verträge abgeschlossen. Verwaltungs- und Umgangssprache
wurde das Latein. Die Wirtschaft, insbesondere die Goldgewinnung im
Siebenbürgischen Erzgebirge (vornehmlich in Ampelum und Alburnus Maior),
erlebte einen nie dagewesenen Aufschwung. Die neuen Straßen und die
Wasserwege ermöglichten Handelsbeziehungen mit den anderen Provinzen des
Reiches.
Siebenbürgen wurde damit für eineinhalb Jahrhunderte Teil
einer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gemeinschaft, die weite
Teile Europas umfaßt hat und bis heute weiterwirkt, viele seiner Bewohner
konnten stolz von sich sagen: "civis Romanus sum".
Dakien war allerdings von Anfang an ein römischer Vorposten,
jenseits der natürlichen Grenzen des Imperiums, die im Norden oftmals an
großen Flüssen halt machten. Schon einige Jahrzehnte nach der
Eroberung mußte das Reich die Angriffe "barbarischer" Stämme
abwehren. Die Einfälle der Quaden, Markomannen, Wandalen und Sarmaten
konnten in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts noch zurückgewiesen
werden. Der Kampf gegen die Goten, die seit 235 vom nordpontischen Raum aus
immer wieder die Provinz verwüsteten, zehrte jedoch an den Kräften
des ohnedies geschwächten Reiches. Kaiser Aurelian zog im Jahre 271 die
Konsequenzen: Er verzichtete auf Dakien, räumte die strategisch exponierte
Provinz und verschanzte sich an der Donaulinie.
An der Darstellung der Räumung Dakiens scheiden sich die
historiographischen Geister. Vornehmlich aufgrund zeitgenössischer
politischer Überlegungen, die ein historisches Recht auf Siebenbürgen
zu belegen versuchen, wird eine Umsiedlung aller Bewohner angenommen oder in
Frage gestellt. Die einen Historiker gehen davon aus, daß in
Siebenbürgen nach 271 keine romanisierte Bevölkerung mehr verblieben
ist, die anderen beharren auf der These einer dakisch-römischen
Kontinuität. Da die Schriftquellen zur Geschichte Siebenbürgens ab
dem 3. Jahrhundert für mehrere Jahrhunderte versiegen und kaum etwas zu
dieser Streitfrage aussagen, auch die Archäologie offenbar keine
erschöpfende Antwort zu geben vermag, kann weder die eine, noch die andere
These endgültig befürwortet oder abgelehnt werden. Man kann annehmen,
daß zwar die Städte und die großen Legionslager geräumt
wurden und damit das römische Städtewesen in Siebenbürgen ein
Ende gefunden hat. Jedoch erscheint es als gesichert, daß ein Teil der
vulgärlateinisch sprechenden und weitgehend christianisierten
dakisch-romanischen Bevölkerung in kleineren, abgelegenen Siedlungen
weitergelebt hat, worauf einige Funde aus dem 4.-7. Jahrhundert (Zeugnisse des
frühen Christentums, römische Münzen, Bruchstücke
lateinischer Inschriften wie das Donarium von Birthälm, u. ä.)
schließen lassen. Diese Bevölkerung wurde aber im Laufe der
Jahrhunderte zunehmend dezimiert, ihre aus Holz hergestellten Werkzeuge und
Bauten sind inzwischen verrottet, von Archäologen nicht aufspürbar.
Man kann nur hoffen, daß die politisch bedingte Polemik über
die Bevölkerungskontinuität oder -diskontinuität im
Siebenbürgen der poströmischen und der Völkerwanderungszeit auf
eine wissenschaftlich-sachliche Ebene gehoben werden kann, zumal es sich um
einen längst hinfälligen historischen Argumentationsversuch für
territoriale Ansprüche handelt: Niemand stellt z. B. heute ernsthaft die
Frage, ob die Ureinwohner Amerikas ein historisches Recht auf das Gebiet der
Vereinigten Staaten haben!
1.2.3. Völkerwanderungszeit
Rom überließ seine Provinz Dakien ihrem Schicksal: Sieben
Jahrhunderte lang drangen nacheinander germanische, asiatische und slawische
Stämme auf ihren Wegen von Ost nach West, von Nord nach Süd in
Siebenbürgen ein und ließen sich, angezogen auch von den für
die Viehzucht unentbehrlichen Salzvorkommen, für kürzere oder
längere Zeit in Siebenbürgen nieder.
Vor ihrem Rückzug hatten die Römer mit den Goten einen Vertrag
ausgehandelt, der formell ihren Rechtsanspruch auf Dakien bewahrte; einige
römische Vorposten verblieben nördlich der Donau. In
Siebenbürgen ließen sich die Westgoten nieder, die nunmehr auch
tervingi = Waldbewohner genannt werden, im Unterschied zu den im pontischen
Steppengebiet lebenden Ost- oder Tieflandgoten.
Es beginnt eine mehr als sieben Jahrhunderte währende Zeit
politischer Instabilität: Den Goten gelingt es, ihr Herrschaftsgebiet etwa
ein Jahrhundert lang gegen Gepiden, Wandalen und Sarmaten zu verteidigen. Dem
Einfall der Hunnen (376) können sie jedoch nicht widerstehen. Zum Zentrum
des hunnischen Herrschaftsgebildes, das unter Attila/Etzel (435-453) seine
größte Macht entfaltet, wird Pannonien. Nach dem Sieg König
Ardarichs über die Hunnen (455) lassen sich die germanischen Gepiden
für über zwei Jahrhunderte in Siebenbürgen nieder. 567 wird das
Gepidenreich von den verbündeten Awaren und Langobarden zerstört.
Siebenbürgen gehört nun dem Awarenreich an, bis zu dessen Vernichtung
durch Karl den Großen am Ende des 8. Jahrhunderts
Im 9. und 10. Jahrhundert kamen weitere Völker ins Land, so die
Petschenegen und die Bulgaren, die zeitweise die Führungsschicht in
größeren oder kleineren politischen Gebilden (Knesaten und
Wojwodaten) stellten, unter Herrschern wie Menoumorut, Glad oder Gelou.
Der Durchzug und der kürzere oder längere Aufenthalt so
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen haben die ethnisch-kulturelle
Vielfalt Siebenbürgens schon in dessen früher Geschichte
geprägt. Ihre Hinterlassenschaft ist trotzdem recht spärlich, sieht
man von einigen Sprachrelikten sowie von den eindrucksvollen Grabbeigaben und
den in Zeiten der Gefahr vergrabenen Schatz- und Münzhorten ab, die eine
Fortführung des Edelmetallabbaus oder zumindest der Goldwäscherei in
diesem Gebiet belegen. Zu den wertvollsten Funden gehören: die
germanischen Fürstengräber von Apahida (5. Jahrhundert), der
Schatzfund von Klausenburg-Some_eni (5. Jahrhundert), der Firtoscher
Münzhort (4.-6.Jahrhundert).
Die Bevölkerungszahl des Landes war übrigens überraschend
gering. Sie lag in dieser Zeit, einschließlich der zeitweise in
Siebenbürgen siedelnden Teile der jeweiligen Wandervölker, unter
100.000. Fußnote2
Nachhaltiger als die Herrschaft der germanischen und asiatischen
Reitervölker hat die weitgehend gewaltlose Ansiedlung der Slawen gewirkt,
die in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts einsetzte. Sie waren nicht
rasch vorrückende, erobernde Reiternomaden, sondern Hirten, die langsam
voranzogen, aber landnehmend wirkten. Nach dem Verschwinden der germanischen
Goten und Gepiden haben sie die Bevölkerung Siebenbürgens innerhalb
von zwei Jahrhunderten fast völlig slawisiert, was u. a. an der Toponymie,
der Orts- und Flurnamengebung, bis heute erkennbar ist.
Wegen der bereits geschilderten Quellenlage und der
politisch-territorial bestimmten Auseinandersetzung um das "historische Recht"
auf Siebenbürgen bleibt die Herkunft der Rumänen in der
siebenbürgischen Historiographie umstritten. Der Archäologe und
Historiker Kurt Horedt, schon von seiner Herkunft her an den politischen
Aspekten der wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht beteiligt, bietet eine
weitgehend unvoreingenommene und einleuchtende Kompromißlösung an:
Bei der Räumung Dakiens hat das Römische Reich nicht die gesamte
Bevölkerung abgezogen; die verbleibenden Romanen wurden ab dem 7.
Jahrhundert slawisiert; diese slawisierten Romanen vermischten sich mit
romanisierten Thrakern, die seit dem 9. Jahrhundert von der Balkanhalbinsel als
Hirten zuwanderten; in Siebenbürgen ist "bereits im 10 Jahrhundert mit
der Anwesenheit von Rumänen zu rechnen", "eine späte Einwanderung der
Rumänen erst im 13. Jahrhundert ist unwahrscheinlich." Fußnote3
1.2.4 Eingliederung in das mittelalterliche ungarische
Königreich
Eine grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse im
Donau-Karpatenraum erfolgte an der Wende des 9. zum 10. Jahrhundert. Beginnend
mit dem Jahr 895 nahmen die finno-ugrischen Magyaren (Ungarn), aus dem
nördlichen Schwarzmeergebiet über die Waldkarpaten eindringend, die
pannonische Tiefebene in ihren Besitz. Zur Sicherung der neuen Heimat und zur
Abschreckung der Nachbarn unternahmen sie bald Streifzüge nach Westen, die
in Raub- und Beutezüge ausarteten und das spätkarolingische
Westeuropa ein halbes Jahrhundert lang in Angst und Schrecken versetzten.
Bereits 898 drangen die Magyaren in Oberitalien ein, 907 schlugen sie die
Bayern unter Markgraf Luitpold vernichtend. Sengend und plündernd
gelangten sie in der Folgezeit bis nach Otranto im Süden, nach Spanien im
Südwesten und nach Bremen im Nordwesten.
Erst König Otto I. ist es auf dem Lechfeld bei Augsburg (955)
gelungen, die Magyaren vernichtend zu schlagen. Sein Sieg, der ihm den Beinamen
"der Große" eingetragen hat, setzte den ungarischen Einfällen ein
Ende. Die Zeitgenossen, auch die unterlegenen Magyaren, werteten das Ereignis
als einen Sieg der Christenheit. Die Schlacht trug dazu bei, daß sich die
Magyaren unter ihrem Großfürsten Geysa (972-997) aus dem Geschlecht
der Arpaden dem Christentum zuwandten und sich staatlich zu organisieren
begannen. Statt der Konfrontation suchten sie nun die Kooperation mit dem
Abendland, dessen Religion sie übernahmen und deren staatliche
Organisationsformen sie als Vorbild betrachteten.
Diese Politik setzte Geysas Sohn Vajk, der mit der Taufe den
christlichen Namen des Passauer Schutzpatrons Stephan erhielt und 997
Großfürst wurde, entschieden fort. Eine wichtige Stütze waren
ihm seine Frau Gisela, eine Schwester des späteren Kaisers Heinrich II.,
und die in ihrem Gefolge ins Land kommenden Ratgeber bayerischer Herkunft. Das
katholische Christentum konnte sich dank Stephans Unterstützung gegen
heidnische und ostkirchliche, von Byzanz genährte Widerstände
durchsetzen, der tiefgläubige König gründete mehrere
Bistümer und Klöster. Im Jahre 1083 wurde er dafür heilig
gesprochen. Die Gesetzgebung, die Organisation der Verwaltung, die
Münzprägung und das lateinische Urkundenwesen des Staates wurden in
Anlehnung an das Kaiserreich aufgebaut.
Diese Bemühungen wurden von Kaiser Otto III. und Papst Silvester
II. honoriert und fanden, wohl am 1. Januar 1001, in der Krönung Stephans
ihren symbolischen Ausdruck. Das abendländisch-christliche Königreich
Ungarn wurde Mitglied der christlichen Staatengemeinschaft, ideell dem Heiligen
Römischen Reich zugehörig, faktisch aber unabhängig.
Zwischen dem Deutschen und dem Byzantinischen Reich, den beiden
Imperien, die jeweils für sich die Nachfolge des Römischen Reiches
beanspruchten, entwickelte sich Ungarn zu einem wichtigen Faktor der ostmittel-
und südosteuropäischen Politik. Seine Expansionsbestrebungen galten
im Südwesten dem Zugang zum Adriatischen Meer, im Osten dem Erwerb
Siebenbürgens, wegen seiner Bodenschätze, besonders wegen des
für die Viehzucht dringend benötigten Salzes und wegen seiner
Funktion als natürliches Bollwerk gegen Angriffe aus dem Osten und
Südosten des Kontinents.
Das Vorrücken der Magyaren in Siebenbürgen im 10.-12.
Jahrhundert wirkte sich nachhaltig auf die geschichtliche Entwicklung des
Landes aus, das sie, von Pannonien aus gesehen, als "Land jenseits der
Wälder" bezeichneten. Die Landnahme Siebenbürgens erfolgte in
mehreren Etappen, die von der innenpolitischen Situation in Ungarn, vom
Widerstand der kleineren siebenbürgischen Herrschaftsbildungen, von den
Beziehungen zum Byzantinischen Reich und zum Walachisch-Bulgarischen Zarat
bestimmt wurden.
Zunächst setzten sie sich im 10. Jahrhundert in
Westsiebenbürgen fest, dort wo sich Salzvorkommen befanden oder der
Salztransport gesichert werden mußte: Am Kleinen Somesch, nach dem Sieg
des ungarischen Heerführers Tuhutum über den einheimischen Wojwoden
Gelou, und am Mittellauf des Mieresch, unter der Führung eines Gyula
(Stammesfürsten), der Weißenburg zu seinem Sitz auserkor. Nach der
Entmachtung des eigenwilligen Gyula (1003) schloß Stephan der Heilige
dieses damals als "sehr großes und reiches Land" charakterisierte
Gebiet enger an den ungarischen Staat an. Ein Sieg über die um die Mitte
des 11. Jahrhunderts eingefallenen Petschenegen (1068 bei Kyrieleis) beendete
deren kurzfristige Herrschaft in Teilen von Siebenbürgen und weitete den
ungarischen Herrschaftsbereich nach Osten aus. König Ladislaus der Heilige
(1077-1095) konnte die Grenze an die Große Kokel und an den Oberlauf des
Mieresch verlagern. Im 12. Jahrhundert rückten die Ungarn bis an den Alt
vor, und erst um die Wende zum 13. Jahrhundert wurden die Ost- und
Südkarpaten erreicht, gehörte ganz Siebenbürgen zum
mittelalterlichen ungarischen Königreich.
Diese Etappen konnten im Gelände an den Spuren eines Schutzsystems
festgestellt werden, das die Magyaren an den jeweiligen Grenzen ihres Reiches
angelegt haben und das sich auf 10-40 km breite Ödlandstreifen (Verhaue,
lat. indagines, ung. gyep_) mit Erdburgen und
Grenzwächtersiedlungen an den passierbaren Stellen (den Toren, ung.
kapuk) stützte. Viele Orts- und Riednamen (etwa Kapus/Kopisch)
erinnern bis heute an diese Grenzbefestigungen. Als Wehrbauern wurden an deren
"Toren" sog. Hilfsvölker angesiedelt, denen man dafür als Gruppe
persönliche Freiheit gewährte.
Zu den wichtigsten Grenzwächtern Ungarns gehören die Szekler.
Sie sind wohl ursprünglich ein Türk-Stamm, der sich früh den
Magyaren anschloß. Szeklerorte sind sowohl an der West- als auch an der
Ostgrenze Ungarns nachweisbar, in Siebenbürgen jeweils entlang der
Verhausäume, die im Zuge der etappenweisen Eroberung mehrmals verlegt
worden sind, bis die Szekler um die Mitte des 12. Jahrhunderts ihr heutiges
Siedlungsgebiet in den Senken am Fuße der Ostkarpaten erreichten. So
wurden sie beispielsweise aus der "terra Syculorum terrae Sebus" bei
Mühlbach in den späteren Szeklerstuhl Sepsi an den Ostkarpaten
umgesiedelt.
Nach jedem Vorschieben der Grenze blieb das Ödland der alten
Verhausäume frei und fiel an den König. Die Besiedlung dieses deshalb
so genannten Königsbodens war aus strategischen und wirtschaftlichen
Gründen wichtig. Notwendig erschien es, hier, im Vorfeld der neu
errichteten Verhausäume, eine kriegstüchtige Bevölkerung
anzusiedeln, die zugleich im Stande sein sollte, das Land durch Rodung urbar zu
machen, Akerbau, Handwerk und Handel zu treiben, möglichst auch den
wachsenden Bedarf an Salz und Edelmetallen durch Erschließung der
Bodenschätze zu decken.
Auf die wirtschaftliche Bedeutung, die diesen Siedlern zukommen sollte,
wirft eine der ersten ungarischen Urkunden, in der Siebenbürgen
erwähnt wird, ein bezeichnendes Licht: König Geysa I. dotierte 1075
das von ihm gegründete Benediktinerkloster von Gran unter anderem mit den
Abgaben der "ultra silvam" gelegenen Salinen bei Thorenburg und mit der
Hälfte der königlichen Einkünfte "in loco, qui dicitur
hungarice Aranas, latine autem Aureus". Fußnote4
2. Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen
2.1. Das Reich der Stephanskrone als "Gastland"
Der riesigen Aufgabe der Verteidigung und wirtschaftlichen
Erschließung der erworbenen Territorien waren die Magyaren allein wegen
ihrer geringen Bevölkerungszahl nicht gewachsen, auch die als Grenz- und
Hilfsvölker integrierbaren Bevölkerungsgruppen (oftmals waren es
Flüchtlinge aus der südrussischen Steppe) wurden rar, und der Mangel
an qualifizierten Fachkräften machte sich bald besonders im Bergbau
bemerkbar. Die Magyaren erkannten - wie bereits der Staatsgründer Stephan
der Heilige seinen Sohn Emmerich in einem "Libellus de institutione
morum", einer Art Fürstenspiegel, ermahnte -, daß einwandernde
"Gäste verschiedene Sprachen und Sitten, verschiedene Lehren und Waffen
mit sich bringen, die alle Reiche und den königlichen Hof schmücken
und erhöhen, [...] denn schwach und vergänglich ist ein Reich, in dem
nur eine Sprache gesprochen wird und einerlei Recht gilt". Fußnote5
Um solche Gäste ("hospites") mußte geworben werden,
mit Zusagen die sie anlockten. Verlockend waren im Mittelalter vor allem
Grundbesitz - dafür stand der Königsboden (fundus regius) der
ehemaligen Verhausäume bereit - und Privilegien. Zu diesen gehörten
in jedem Fall jene Rechte, die die Umworbenenen bereits in ihrer Heimat
besaßen und "in ihren Knochen mitbrachten", wie man damals sagte.
Es mußten aber auch Rechte sein, die darüber hinausgingen, um
Menschen dazu zu bewegen, das Risiko der Siedlung in ein tausende Kilometer
entferntes Gebiet auf sich zu nehmen: vor allem persönliche Freiheit und
Freizügigkeit waren damals magische Worte, die eine Standeserhöhung
bedeuteten, Sicherheit boten und besseres Fortkommen versprachen. Sie wurden
ihnen vom ungarischen Staat zugesagt und diese Zusagen wurden auch über
die Jahrhunderte gehalten. 1222 wurde in einer Goldenen Bulle König
Andreas' II., dem Grundgesetz des mittelalterlichen Königreichs Ungarn,
festgehalten, daß die "Gäste jedwelcher Nation in der ihnen von
Anfang an [bei ihrer Ansiedlung] gewährten Freiheit zu erhalten
sind." Fußnote6
Vor allem König Geisa II. (1141-1162) ist es gelungen, auf diese
Weise deutsche und flämische Bauern, Handwerker, Kaufleute und niedere
Adlige (Ministeriale) anzuwerben und in der Zips, in der heutigen Slowakei,
sowie in Siebenbürgen anzusiedeln.
Ihre Kolonisation ist Teil einer umfassenden europäischen Bewegung
des Landesausbaus, die von den wirtschaftlich besonders entwickelten Gebieten
des Kontinents ausging, in denen sich die Bevölkerung sprunghaft vermehrt
hatte. Sie ist als deutsche Ostsiedlung in die Geschichte eingegangen.
Waldgebiete, die durch Rodung erschlossen werden konnten, dann die
menschenarmen Räume Ost- und Südosteuropas boten vor allem
jüngeren Kindern, die durch das Erbrecht benachteiligt waren, die Chance,
Grund und Boden zu erwerben. Die zunehmende Bedrückung der ländlichen
Bevölkerung in den Grundherrschaften hat andere dazu veranlaßt, dem
Ruf in ein fernes Land zuu folgen. Denn es wurde nicht nur vererbbarer
Grundbesitz in Aussicht gestellt sowie persönliche Freiheit und
Freizügigkeit garantiert, sondern meistens auch freie Richter- und
Pfarrerwahl (als Garantie für Jurisdiktion nach eigenem Recht und für
ein eigenes Kirchensprengel) sowie mehrere Freijahre bis zu den ersten Abgaben;
auch Frondienste gab es keine mehr.
Die mittelalterliche deutsche Südostsiedlung erfolgte in Ungarn
nicht durch erobernde Landnahme, sondern auf friedlichem Wege. Der König
selbst hat die Kolonisten in sein Land gerufen.
2.2. Herkunft der Siebenbürger Sachsen
Die siebenbürgisch-sächsische Geschichtsschreibung hat sich
verständlicherweise lange Zeit hindurch und intensiv darum bemüht,
ein möglichst klar umrissenes Herkunftsgebiet der Siedler nachzuweisen,
die dem Ruf König Geisas II. folgend nach Siebenbürgen gekommen sind.
Das Ergebnis ist enttäuschend und belegt nur, daß wohl der Ansatz
falsch war: Die Auswanderung erfolgte, darin sind sich die Wissenschaftler
heute einig, weder aus einem eng begrenzten Raum, noch in einer erheblich
großen Zahl.
Deshalb fiel die Migration auch nicht sonderlich auf, es gibt keine
Schriftquellen, die das Ereignis eindeutig festhalten, lediglich drei
Nachrichten über Personen, die sich in der fraglichen Zeit vom Niederrhein
und aus der Wetterau "nach Ungarn" begeben haben: Anselm aus Braz im
Lütticher Land, Burgvogt von Logne (1103), Hezelo aus der Nähe von
MerksteinFußnote7
(1148, während der Regierungszeit König Geisas II.) und einige
Bewohner von Oppoldishusen (erst 1313 als "ehedem nach Ungarn geflohen"
erwähnt). Ob sie aber wirklich nach Siebenbürgen gezogen sind, ist
fraglich und der Verweis auf die dortigen Ortsnamen Broos, Hetzeldorf,
Groß- und Kleinpold oder Trappold, die mit diesen vorgeblich "ersten
Siebenbürger Sachsen" in Verbindung gebracht werden könnten, ist
wenig überzeugend. Allerdings war es nicht ganz ungewöhnlich,
daß Kolonistenorte in Siebenbürgen nach ihren Begründern, den
Anführern der Siedlergruppen, die mit den schlesischen Lokatoren
vergleichbar wären, benannt worden sind, so der Vorort Hermannstadt,
dessen Namensgeber vielleicht ein ähnlicher "maior hospitum" war
wie der 1181 im südwestungarischen Fünfkirchen bezeugte Hermann.
Recht selten, das Herkunftsgebiet nur vage umschreibend und erst im
letzten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts abgefaßt sind auch die ersten
Urkunden der ungarischen Könige, der siebenbürgischen Woiwoden, der
päpstlichen Kanzlei und des Siebenbürgischen Bistums, die sich auf
die neuen Siedler beziehen: 1186 werden erstmals, aber ganz allgemein, die
"fremden Gastsiedler des Königs von jenseits der Wälder"
erwähnt, 1191 ist von der "ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum"
die Rede, 1192-1196 werden die "priores Flandrenses" genannt, 1206
fällt dann der Name "Saxones", der sich schließlich in der
ungarischen Kanzleisprache durchsetzte und die Siebenbürger bis heute als
"Sachsen" ausweist.
Als Sachsen werden allerdings überall im mittelalterlichen Ungarn
die Inhaber von Privilegien bezeichnet, die zunächst von sächsischen
Bergleuten ausgehandelt worden sind, die man als seltene Fachleute für den
Abbau der Bodenschätze dringend benötigte, in der Zips oder in
Siebenbürgen ebenso wie in Bosnien und Serbien. Die Bergrechte, die man
ihnen zusicherte, um sie ins Land zu locken und zum Bleiben zu veranlassen,
enthalten den ganzen Katalog von Vorrechten, den mittelalterliche Kolonisten in
Ungarn beanspruchen konnten: persönliche Freiheit, vererbbaren Besitz,
eigene Verwaltung und Gerichtsbarkeit, kirchliche Autonomie durch freie
Pfarrerwahl, geregelte, damit kalkulierbare Abgaben und sonstige Pflichten.
"Sachse" war somit synonym mit einem Rechtsstatus und nicht, wenn
überhaupt, ein Herkunftsname.
Die Mundartforschung, die angesichts der über die Herkunft kaum
aussagefähigen Quellen versucht hat, das Ausreisegebiet der
Siebenbürger Sachsen aufgrund ihres spezifischen Dialektes zu
ergründen, hat dementsprechend auch kaum Belege für eine
sächsische Emigration nach Transylvanien finden können. Vielmehr
wurde, aufgrund frappierender Ähnlichkeiten mit dem "Letzelburger Platt",
der moselfränkische Raum als "Urheimat" identifiziert. Jedoch sind auch
bayerische, nord- und mitteldeutsche Spracheinflüsse nachgewiesen worden.
Und die These einer parallelen, voneinander unabhängigen Entwicklung von
zwei isolierten Sprachinseln im Westen bzw. im Südosten Europas (die eine
in Luxemburg, die andere in Siebenbürgen) sorgt für zusätzliche
Unsicherheit.
Nicht zuletzt haben neuere lithurgiegeschichtliche Untersuchungen
mittelalterlicher Meßbücher aus Siebenbürgen nicht nur
Parallelen zur Kirchenprovinz Köln, sondern auch zum Magdeburger Raum
aufgezeigt, die die Annahme belegen könnten, daß die Migranten
zumindest einen "Zwischenaufenthalt" an Elbe und Saale genommen haben oder
daß sie enttäuschte Teilnehmer des Wendenkreuzzuges von 1147 gewesen
sind.
Aufgrund der sogenannten grauen Keramik haben Archäologen zumindest
für Nordsiebenbürgen ebenfalls die Einwanderung einer
größeren Zahl von Kolonisten aus Mitteldeutschland angenommen. Ein
bei Schellenberg gefundenes Kultgefäß weist hingegen
Ähnlichkeiten mit einer Kanne aus Riethnordhausen in Thüringen auf
und wird auch mit einer Hildesheimer Werkstatt in Verbindung gebracht. Die
"fränkische" Bauweise der siebenbürgisch-sächsischen Häuser
und die süddeutsche Romanik der Kirchen wiederum deuten in eine andere
Herkunftsrichtung. Ebenso die Analogien des Bildmotivs auf einem in Heltau bei
Hermannstadt und einem an der Mosel, in Faha bei Trier gefundenen Grabstein.
Zweifellos gehörten zu den Siedlern nicht nur Deutsche, seien es
nun Theutonici aus Süddeutschland oder Saxones aus dem
mittel- und norddeutschen Raum, sondern auch Romanen aus den westlichen
Gebieten des damaligen Deutschen Reiches. Auf Flandrenses, die zumindest
zwei gesonderte Siedlergruppen gebildet haben, weist schon eine der
frühesten über die Siebenbürger Sachsen hin.
Diese kamen aus einer wirtschaftlich hoch entwickelten Reichsgrafschaft,
in der im 11.-12. Jahrhundert eine intensive Binnenkolonisation betrieben und
dem Landmangel durch Eindeichungen begegnet wurde, in der zahlreiche
Städte dank der Tuchproduktion und des Handels entstanden und aus der
zahlreiche Ritter in den Ersten Kreuzzug gezogen waren. Flamen haben
bekanntlich in der deutschen Ostsiedlung allgemein eine wichtige Rolle
gespielt.
Latini, Siedler romanisch-wallonischer Herkunft, waren ebenfalls
vertreten, so der miles Johannes Latinus, der als Ritter, aber auch als
ein früher siebenbürgischer Fernkaufmann aufgetreten ist, der
Gräf Gyan aus dem Bergort Salzburg, der den Weißenburger Bischof das
Fürchten lehrte, oder der Magister Gocelinus, der Michelsberg an die
Zisterzienserabtei Kerz geschenkt hat. Hinzuweisen ist auch auf den Ortsnamen
Waldorf (villa Latina, "Wallonendorf") oder auf die villa Barbant
oder Barbantina, deren Namen an das belgische Brabant erinnern
könnte.
Aufgrund der geschilderten, oft widersprüchlichen
Forschungsergebnisse kann die Herkunftsfrage der Siebenbürger Sachsen
nicht als abschließend geklärt betrachtet werden. Eine Klärung
ist angesichts der Quellenlage auch kaum zu erwarten und erübrigt sich,
wenn man davon ausgeht, daß die Kolonisten in kleinen Gruppen aus allen
Gebieten des damaligen Reiches ausgewandert, unterschiedlicher regionaler und
ethnischer Herkunft sind, und erst in Siebenbürgen zur einer Gruppe mit
eigenem Identitätsbewußtsein, mit deutscher Sprache und Kultur
zusammengewachsen sind. Ohnehin war ihre Zahl verschwindend gering, sie wird
auf 520 Familien, etwa 2600 Personen, geschätzt.
2.3. Verlauf der Ansiedlung
2.3.1. Beginn
In der Zeit des Ersten und des Zweiten Kreuzzuges (1096-1099;
1147-1149), die auf dem Festland durch Pannonien über die Balkanhalbinsel
und Kleinasien ins Heilige Land unternommen worden sind, wurde man im Westen
offenbar auf Ungarn als ein verlockendes Land aufmerksam, das der
zeitgenössische deutsche Chronist und Bischof Otto von Freising als
"Paradies Gottes" preist. Eine unmittelbare Wirkung der Kreuzzüge auf die
Auswanderer aus dem Reich ins mittelalterliche Ungarn kann allerdings nur
angenommen werden. Und durch Siebenbürgen sind die Kreuzfahrer zweifellos
nicht gezogen.
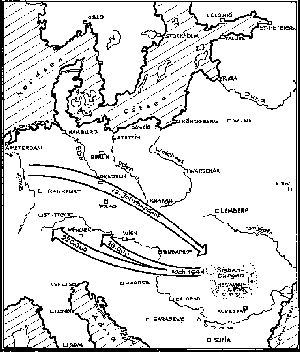
Während des Zweiten Kreuzzuges kam König Konrad III. im Jahre
1147 mit seinem Heer durch Ungarn. Hier regierte Königs Geisa
(Géza) II. (1141-1162), dem der 1224 ausgestellte Freibrief der
Siebenbürger Sachsen das Verdienst zuschreibt, "deutsche Gäste" ins
Land gerufen zu haben. 1991, 850 Jahre nach seinem Regierungsantritt, wurde
deshalb unter anderem in der Frankfurter Paulskirche der Ansiedlung der
Siebenbürger Sachsen gedacht. Man war sich allerdings der Tatsache
bewußt, daß diese Feier kein genaues, sondern nur ein symbolisches,
wenngleich durchaus auch mögliches Datum berücksichtigen konnte.Fußnote8
Bei seiner Krönung war Geisa erst elf Jahre alt, die
Regierungsgeschäfte übten als Vormund seine Mutter Ilona und deren
serbischer Bruder Belos aus. Die Beziehungen zum Reich waren 1141 gut, die 1139
kundgetane Verlobung von Geisas jüngerer Schwester Sophie mit dem
vierjährigen deutschen Kronprinzen Heinrich sollte die dynastische
Verbindung zwischen den Staufern und den Arpaden vertiefen; deutsche Siedler
waren damals in Ungarn zweifellos willkommen.
Vier Jahre später wurde diese Verlobung von deutscher Seite
gelöst, ein Affront, der 1146 zu kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen dem Reich und Ungarn führte, und ein Siedlungswerk
unwahrscheinlich macht.
Kurz nachdem er die Selbstregierung übernommen hatte, traf Geisa
II. höchstwahrscheinlich im Juli 1147 den durch Ungarn ziehenden
Kreuzfahrer Konrad III. Eine Absprache über eine deutsche Siedlungsaktion
nach Siebenbürgen könnte bei dieser Gelegenheit getroffen worden
sein, wenngleich die Chroniken nicht nur von der Gastfreundlichkeit der
Magyaren, sondern auch von deren Auseinandersetzungen mit den zuweilen
gewalttätigen Deutschen berichten. Ein Jahr danach, 1148, bestellte
jedenfalls der bereits erwähnte Hezelo von Merkstein sein Haus, weil er
nach Ungarn auswanderte, jedoch weiß man leider nicht, ob er wirklich bis
nach Siebenbürgen gekommen ist.
Nach 1148 verschlechterten sich die deutsch-ungarischen Beziehungen und
nach Konrads III. Tod kam es fast zum Krieg, keine günstige Zeit für
die Werbung von Kolonisten aus dem Reich. Eine engere ungarisch-deutsche
Kooperation bahnte sich wieder im Jahre 1158 an, als eine ungarische
Gesandtschaft auf dem Regensburger Reichstag Kaiser Friedrich Barbarossa
Waffenhilfe für den bevorstehenden Italienfeldzug anbot und vielleicht
auch die Siedlungsaktion nach Siebenbürgen absprach. Seit Ende des Jahres
1159 kühlten sich die deutsch-ungarischen Beziehungen wieder ab, denn
Geisa verstärkte die Kontakte zu Papst Alexander III. und zum
französischen Känig Ludwig VII., zwei erklärten Gegnern
Barbarossas. 1162 ist der Ungarnkönig dann, erst 31jährig, gestorben.
Für die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen, die zu seinen
historischen Verdiensten gezählt wird und die nur in Zeiten des
Einvernehmens mit deren Herkunftsland erfolgen konnte, kommen daher nur die
drei relativ kurze Zeiträume in Betracht.
2.3.2. Etappen
Ob nun die Ansiedlung im Jahre 1141, 1147 oder erst 1158 in die Wege
geleitet wurde, wird wohl nie geklärt werden können, sicher ist nur,
daß sie in der Regierungszeit Geisas II. um die Mitte des 12.
Jahrhunderts begann und, mit Unterbrechungen, mehr als ein Jahrhundert dauerte.
Sie verlief in mehreren Etappen, die im Gelände am Vorschieben der
Verhausäume lokalisiert werden können, die nach der Inbesitznahme
weiterer Teile Siebenbürgens durch die ungarische Krone angelegt worden
sind, bis die Karpaten erreicht wurden. Fußnote9 Nun verzichtete man auf
die traditionelle Grenzssicherung durch Verhaue zugunsten von Wehrsiedlungen
auf Königsboden. Die freigewordenen Ödlandstreifen, in den Urkunden
auch als terra deserta bezeichnet, verlieh man den ins Land Gerufenen.
In der ersten Siedlungsetappe (bis Ende des 12. Jahrhunderts) wurden in
Nordsiebenbürgen einige Bergbauorte (um Kolosch, Desch und Seck), am
Mittellauf des Mieresch die Dörfer der primi hospites in der
Nähe von Weißenburg (Krakau, Krapundorf, Rumes, Barbant) und am
Zibin und Alt die Ortschaften der Hermannstädter Provinz, des sogenannten
Altlandes um Hermannstadt, Leschkirch und Großschenk angelegt. Für
diese Kolonisten wurde 1188-1191 die exemte Hermannstädter Propstei
gegründet, die unmittelbar dem fernen Erzbistum Gran unterstellt und in
Kapitel gegliedert war.
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts war die ungarische Landnahme
Siebenbürgens weitgehend abgeschlossen, die Grenze des Königreichs
bildeten nun die Karpaten. In den darauffolgenden beiden ersten Jahrzehnten des
13. Jahrhunderts wurden in einer zweiten Etappe vom Altland aus
Sekundärsiedlungen im Harbachtal sowie am Fuße des Zibins- und des
Mühlbacher Gebirges gegründet. Vermutlich trafen auch weitere
Kolonisten aus dem Abendland ein. Damals gab man auch die Verhausäume im
Raum Mühlbach auf und verlegte die Szekler aus den dortigen Grenzorten in
ihre heutigen Wohngebiete im Osten des Landes. Das deutsche Siedlungsgebiet in
Südsiebenbürgen erreichte seine im Andreanischen Freibrief von 1224
angeführte west-östliche Ausdehnung von Broos bis Draas.
2.3.2.1. Der Deutsche Orden im Burzenland
Zu dieser Zeit berief König Andreas II. auch den Deutschen Orden
ins Burzenland. Dieses im Karpatenbogen gelegene Gebiet, in das mehrere
Pässe aus dem Osten und Süden führten, war besonders
gefährdet und strategisch wichtig. Von hier aus sollten auch Gebiete
jenseits der Karpaten für die Christenheit, vor allem aber für die
ungarische Krone, erschlossen werden. Nachdem der Schutz der südlichen und
nordöstlichen Grenze Siebenbürgens den "Sachsen", jener der
östlichen den Szeklern anvertraut worden waren, wurde für die
südöstliche eine zu Verteidigung, Expansion und Mission
gleichermaßen befähigte Gruppe gesucht. Die Wahl fiel auf den
Deutschen Orden, dessen Hochmeister Hermann von Salza aus Thüringen
stammte. Zu Thüringen hatte das ungarische Herrscherhaus im Jahre 1211
Familienbeziehungen geknüpft: Wohl unter dem Einfluß der
Königin Gertrud aus dem bayerischen Geschlecht derer von Andechs-Meranien,
wurde die (später, 1235, heiliggesprochene) Königstochter Elisabeth
von Ungarn mit Ludwig, dem künftigen Landgrafen von Thüringen
(1217-1227) verlobt. Es ist wohl kein Zufall, daß im gleichen Jahr der
Deutsche Orden nach Siebenbürgen berufen wurde.
Die kriegserfahrenen Mönche erhielten das Gebiet der
Burzenländer Senke mit der Erlaubnis, dort - allerdings nur aus Holz -
Burgen und Städte zu bauen, keine Steuern zu zahlen, zollfreie Märkte
abzuhalten, die Hälfte des geschürften Goldes und Silbers zu behalten
und den Woiwoden nicht zu bewirten. Sie wurden allein der königlichen
Gerichtsbarkeit, kirchlich direkt der römischen Kurie unterstellt.
Dafür sollten sie die Landesgrenzen gegen die einfallenden Kumanen
verteidigen, diese und andere Völker jenseits der Karpaten zum
katholischen Glauben bekehren und nach Möglichkeit das ungarische
Herrschaftsgebiet in diesen Raum ausweiten.
Die Ritter gründeten mehrere Ortschaften und bauten eine erste
Marienburg am Alt als Ordenssitz. In die Gründungen riefen sie deutsche
Siedler, vornehmlich aus der Hermannstädter Provinz. Jüngste, noch
nicht abgeschlossene Ausgrabungen deuten aber auch auf eine frühere
Anwesenheit abendländischer Kolonisten in diesem Gebiet.
Der Aufenthalt des Deutschordens in Siebenbürgen blieb eine
Episode: vierzehn Jahre später, 1225, wurde er des Landes verwiesen.
2.3.3. Privilegierung
Die vorteilhaften Bedingungen des ungarischen Gastrechtes hat Geisa II.
jenen angeboten die er in sein Reich gerufen hat. Schriftlich festgehalten
wurden sie 1224 im "Goldenen Freibrief" seines Nachfolgers Andreas II., der
"das am besten ausgearbeitete und weitestgehende Siedlerrecht, das
westlichen Siedlern in Osteuropa verliehen wurde" enthält.
Freibrief der Siebenbürger Sachsen (1224)
Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit und unteilbaren Einheit. Andreas von
Gottes Gnaden König von Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Bosnien, Serbien,
Galizien und Lodomerien für immer.
So wie es zur königlichen Würde gehört, der
Hochmütigen Widerspenstigkeit machtvoll niederzuhalten, so ziemt es sich
auch für die königliche Güte, der Demütigen Drangsale
barmherzig zu erleichtern, der Getreuen Dienst zu schützen und jedem
seinen Verdiensten entsprechend das Gebührende gnädig
zuzuteilen.
Da sind nun Unsere getreuen Gastsiedler, die Deutschen jenseits
des Waldes (Siebenbürgen), gemeinschaftlich an Unsere Majestät
herangetreten, haben Uns demütig ihre Klagen vorgetragen und durch ihre
Klagen und Flehen darauf hingewiesen, daß sie ihre Freiheit, mit der sie
von Unserem Großvater, dem allergnädigsten König Geisa,
geworben worden waren, vollends einbüßen würden, wenn
Königliche Majestät nicht, wie gewohnt, ihr Auge gnädig auf sie
richte. Darum, aus Armut und großem Mangel, konnten sie Königlicher
Majestät keinen Dienst leisten.
Indem wir ihren gerechten Klagen wie gewohnt ein gnädiges
Ohr leihen, wollen Wir also, daß bei Gegenwärtigen und
Zukünftigen bekannt wird, daß Wir, den Gnadenspuren Unserer
Vorgänger folgend und im Innersten bewegt, ihnen die fürühere
Freiheit zurückgegeben haben. Und zwar so, daß
- alles Volk von Waras bis Boralt mitsamt dem Szeklergebiet
des Landes Sebus und dem Lande Daraus eine politische Gemeinschaft (unus
populus) bilden und unter einem einzigen Richter stehen soll. Gleichzeitig
sollen alle Grafschaften (comitatus) außer der von Hermannstadt (ihre
Tätigkeit) einstellen.
- Wer aber Hermannstädter Graf wird, darf in den
genannten Grafschaften (als Richter/Beamte) nur solche einsetzen, die
ständig unter ihnen wohnen; und die politischen Gemeinden (populi) sollen
(zum Richter/Beamten) jeweils den wählen, von dem angenommen werden kann,
daß er (sein Amt) besonders gut verwalten wird. Es soll auch niemand in
der Hermannstädter Grafschaft wagen, (ein Amt) mit Geld zu
kaufen.
- Sie sollen jährlich 500 Silbermark zum Nutzen Unserer
Kammer zahlen. Wir wollen, daß kein Grundherr oder sonst jemand, der in
ihrem Gebiet ansässig ist, von dieser Aufgabe ausgenommen wird, es sei
denn, er besitzt darüber ein besonderes Privileg. Auch das bewilligen Wir
ihnen, daß sie das Geld, das sie uns künftig zahlen müssen, in
keinem anderen Gewicht zahlen als in der Silbermark, die ihnen Unser Vater Bela
frommen Angedenkens bestimmt hat, nämlich 4 1/2 Vierdung (= 1 Mark und 2
Lot) Hermannstädter Gewichts, wie der Kölner Pfennig, damit sich beim
Wiegen keine Differenz ergibt. Sie sollen sich nicht weigern, den Boten, die
Königliche Majestät zum Sammeln des besorgten Geldes einsetzen wird,
für ihre Ausgaben an jedem Tag, den sie dort weilen, drei Lot zu
zahlen.
- Es sollen 500 Bewaffnete (milites) gestellt werden, um bei
einer Heerfahrt des Königs im Reich Kriegsdienst zu leisten.
Außerhalb des Reiches müssen sie 100 Bewaffnete entsenden, wenn der
König selbst (ins Feld) zieht. Wenn er aber einen Adligen (iobagionem)
über die Reichsgrenze schickt, es sei um einem Freund zuhelfen oder in
eigener Sache, dann müssen sie nur 50 Bewaffnete entsenden. Weder darf der
Königüber die genannte Zahl hinaus (Bewaffnete) anfordern, noch
müssen sie selbst solche entsenden.
- Sie sollen ihre Pfarrer (sacerdotes) frei wählen und
die Gewählten (dem Bischof) vorstellen. Sie sollen ihnen den Zehnten
geben, und in allem kirchlichen Recht solle sie ihnen nach altem Herkommen Rede
und Antwort stehen.
- Wir wollen auch und befehlen rechtswirksam, daß
niemand über sie richten solle außer Wir selbst oder der
Hermannstädter Graf, den Wir ihnen für Ort und Zeit einsetzen werden.
Wenn sie aber vor irgendeinem Richter stehen, dan müssen diese das
Verfahren stets dem Gewohnheitsrecht (der Siedler) entsprechend
durchführen. Auch darf sie niemand vor Unser Gericht laden, es sei denn,
der Fall kann vor ihrem eigenen Richter nicht entschieden werden.
- Außer dem oben Angeführten haben Wir ihnen den
Wlachen- und Bissenenwald und seine Gewässer zur gemeinsamen Nutzung mit
den erwähnten Wlachenund Bissenen (= Petschenegen) übertragen, ohne
daß sie im Genuß der genannten Freiheit deswegen Dienste leisten
müßten.
- Darüber hinaus haben Wir ihnen gestattet, ein einziges
Siegel zu führen, das bei Uns und Unseren Großen (magnates)
öffentlich anerkannt werden soll.
- Wenn einer von ihnen jemanden wegen einer Geldsache
gerichtlich belangen will, soll er vor dem Richter nur solche Personen als
Zeugen benennen können, die in ihrem Gebiet ansässig sind. Wir
befreien sie vollständig von jeder (fremden) Gerichtsbarkeit.
- Der alten Freiheit folgend, bewilligen Wir ihnen allen
jeweils acht Tage lang den freien Bezug von Kleinsalz um das Fest des hl. Georg
(23. April), um das Fest des hl. Königs Stephan (2. September) und um das
Fest des hl. Martin (11. November). Darüber hinaus gewähren Wir
ihnen, daß keiner der Zolleinnehmer sie behindern darf, weder bei der
Hinfahrt, noch bei der Rückfahrt.
- Den Wald aber mit all seinem Zubehör und die Nutzung
der Gewässer mit ihren Flußläufen, die allein der König zu
vergeben hat, überlassen Wir allen, den Armen wie auch den Reichen, zur
freien Verwendung.
- Wir wollen auch und befehlen kraft königlicher
Autorität, daß keiner Unserer Adligen (iobagiones) ein Dorf oder
irgendein Landgut von königlicher Majestät zu fordern wage. Wenn aber
einer (ein Dorf oder Landgut) fordert, dan sollen sie aufgrund der ihnen von
Uns gegebenen Freiheit Einspruch erheben.
- Darüber hinaus setzen Wir für besagte Getreue
fest, daß, wenn Wir auf einer Heerfahrt zu ihnen kommen sollten, sie nur
drei Bewirtungen für Uns geben müssen. Wenn aber der Woiwode in
Geschäften des Königs zu ihnen selbst oder durch ihr Gebiet geschickt
wird, dann sollen sie sich nicht weigern, zwei Bewirtungen zu geben, eine bei
der Einreise und eine bei der Ausreise.
- Auch fügen Wir den obengenannten Freiheiten der
Besagten hinzu, daß ihre Kaufleute überall in Unserem
Königreich frei und ohne Abgabe hin- und herreisen dürfen, wobei sie
ihr Recht unter Hinweis auf die königliche Hoheit wirksam geltend machen
sollen.
- Wir befehlen, daß bei ihnen selbst auch alle ihre
Märkte abgabenfrei gehalten werden.
- Damit aber das, was oben gesagt ist, in Zukunft
rechtswirksam und unerschüttert bleibt, haben Wir dieses Blattmit dem
Schutz Unseres doppelten Siegels bekräftigt.
Gegeben im 1224. Jahr nach der Menschwerdung des Herrn, in 21.
Jahr Unseres Königtums.
Aus: Ernst Wagner (Hg.): Quellen zur Geschichte der
Siebenbürger Sachsen. 21981, Nr. 5, S. 16-19. |
Für die Nutznießer dieser Rechte - deutsche Kolonisten
unterschiedlicher landschaftlicher Herkunft, die anfangs als "hospites
Theutonici" oder auch als "Flandrenses" bezeichnet wurden, setzte sich die in
der ungarischen Kanzlei benutzte Kollektivbezeichnung "Saxones" durch, die auch
für die deutschen Siedler in der Zips und die deutschen Bergleute auf dem
Balkan (im damals zu Ungarn gehörenden Bosnien und Kroatien ebenso wie in
Serbien und im Osmanischen reich) benutz wurde und offenbar die Inhaber der
Privilegien nach dem "jus Theutonicum" meinte.
Als mit den schlesischen Lokatoren vergleichbare Siedlungsunternehmer,
die zwischen König und Kolonisten vermittelten, die Privilegien
aushandelten und neue Ortschaften gründeten, dürften die sog.
Gräfen aufgetreten sein, die auch die erste Führungsschicht der
Siebenbürger Sachsen gebildet haben und wohl der deutschen
Ministerialität entstammten.
3. Politische Geschichte und wirtschaftliche Entwicklung im
Mittelalter
Diese "Siebenbürger Sachsen" haben die ihnen zugewiesenen Gebiete
in kurzer Zeit wirtschaftlich erschlossen, nicht nur den Boden nutzbar gemacht
und die Agrartechnik verbessert, sondern auch die edelmetallreichen Gebiete der
West- und Ostkarpaten (Siebenbürgisches Erzgebirge, Rodenauer Berge) und
die Salzstöcke im Siebenbürgischen Hochland erschlossen, Gewerbe und
Handel vorangebracht. Bereits 1186 konnte der ungarische König von den
"hospites regis de Ultrasylvas" mit Abgaben in Höhe von 15 000 Silbermark
rechnen.
Die aufstrebende Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen wurde - wie
die anderen Völker dieses Raumes - durch den Mongolensturm von 1241 einer
schweren Belastung ausgesetzt. Die "tatarischen" Reiter fielen fast
gleichzeitig über mehrere Karpatenpässe in das Land ein,
überwanden das alte Grenzschutzsystem fast mühelos, besiegten das
ungarische Ritterheer bei Mohi, verwüsteten ganze Landstriche. Auf
zunächst erfolgreichen Widerstand stießen sie offenbar nur bei den
Sachsen. In der Bergstadt Rodenau, berichtet ein Zeitgenosse, stellte sich der
Stadtrichter Ariscaldus mit "sechshundert auserlesenen deutschen Bewaffneten"
den Mongolen entgegen. Erst durch eine List, einen vorgetäuschten
Rückzug, auf den die Verteidiger "wie es die deutsche Leidenschaft
erfordert", mit einem siegestrunkenen Vollrausch reagierten, konnte der Ort
erobert werden.
Der Mongoleneinfall bewirkte eine Neuorientierung der ungarischen
Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik, die nun zunehmend auf die Städte
als Bollwerke gegen fremde Eindringlinge und als Katalysatoren der
ökonomischen Entwicklung setzte. Zu diesem Zweck wurden neue Siedler
angeworben, strategisch und handelspolitisch wichtige Orte durch Privilegien
und Steuervergünstigungen gefördert. Entlang des Karpatenbogens,
vorrangig in der Nähe der Pässe entstand eine Kette deutscher
Handels- und Gewerbezentren wie Bistritz, Kronstadt, Hermannstadt,
Mühlbach und Klausenburg, die sich zu den Bergstädten Rodenau,
Offenburg, Thorenburg und Großschlatten gesellten.
Die Städte, deren Entwicklung unter den ungarischen Königen
Karl I. Robert von Anjou (1308-1342), seinem Sohn Ludwig I. d. Großen
(1342-1382) und unter Sigismund von Luxemburg (1387-1437) konsequent
gefördert wurde, bewirkten den Übergang von der Natural- zur
Geldwirtschaft und bezogen das örtliche Gewerbe wie die Getreide- und
Viehproduktion des Umlandes in den europäischen Warenverkehr ein. Die
erste erhaltene Zunftordnung weist 1376 auf eine fortgeschrittene
Differenzierung des Handwerks hin, die einem Vergleich mit
westeuropäischen Städten durchaus standhält: 25 Gewerbe waren in
19 Zünfte zusammengeschlossen. Die Städte wurden zu wirtschaftlichen
und kulturellen Mittelpunkten des Landes. Sie übernahmen Verfassungs- und
Rechtsnormen deutscher Städte, zum Teil das Magdeburger und das Iglauer
Stadtrecht, oder arbeiteten bereits 1271 ein deutsches "Bergrecht von der
Rodenaw" aus.
Die ummauerten Städte waren seit dem Ende des 14. Jahrhunderts der
wirksamste Schutz gegen die wachsende Bedrohung durch die osmanischen
Türken. Sie widerstanden auch längeren Belagerungen und behinderten
den Vormarsch größerer Truppenverbände, während die
befestigten Dorfkirchen Schutz gegen kleinere Beutezüge boten. Mit diesem
einzigartigen System der Wehrkirchen und befestigten Städten fügten
sich die Siebenbürger Sachsen in das vielgerühmte "Antemurale
Christianitatis" ein, in die Vormauer der Christenheit, welche die
südosteuropäischen Völker gegen die vordringenden Türken
gebildet haben. Nach dem Fall von Konstantinopel (1453) konnte der
Bürgermeister von Hermannstadt stolz schreiben, seine Stadt sei nun
"nicht allein des Königreichs Ungarn, sondern auch der ganzen
Christenheit Schild und Schirm".
Die osmanische Bedrohung, aber auch die Gefährdung des
privilegierten Rechtsstandes durch den ungarischen Adel bestimmten das
städtische Bürgertum - angeführt von seiner patrizischen
Oberschicht (Gräfen, später Kaufleute, reiche Handwerker und
Bergbauunternehmer) die Initiative zum politischen Zusammenschluß der
deutschen Siedlergemeinschaften zu ergreifen, die in vier territorial nicht
ganz zusammenhängenden Gebieten lebten (den sog. Sieben Stühlen der
Hermannstädter Provinz, den Zwei Stühlen des Kokelgebietes, dem
Nösner und dem Burzenländer Distrikt). Unter Rückgriff auf die
Vorgabe des Andreanischen Freibriefs ("unus sit populus" - einig sei die
Gemeinschaft) wuchsen diese zur Sächsischen Nationsuniversität
(Universitas Saxonum, d. j. Gesamtheit der Sachsen) zusammen, der
übergeordneten politischen, administrativen und gerichtlichen Instanz der
freien Deutschen aus Siebenbürgen, einer Institution, die in manchem den
Städtebünden in Westeuropa ähnlich ist. Der langwierige
Prozeß fand 1486 seinen Abschluß.
Es entstand damit ein starkes Gemeinwesen, das sich selbst verwaltete
und dessen Bevölkerung allmählich zu einem Volk deutscher
Muttersprache zusammen, mit dem eigentümlichen Dialekt einer
Reliktmundart, die dem Luxemburgischen ähnelt, zu einem Volk mit einer
besonderen Rechtsstellung im mittelalterlich-ungarischen, sich ständisch
gliedernden Staat, mit eigenen Bewußtseinsinhalten, Erfahrungsräumen
und Bewertungsmaßstäben und mit einem besonderen
Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Sächsische
Nationsuniversität repräsentierte einen Stand freier, privilegierter
Bürger und Bauern, war dessen Interessenvertretung im
siebenbürgischen Landtag, dem außerdem der ungarische Adel und die
freien seklerischen Wehrbauern angehörten.
Das Wort Nation wurde damals im Sinne von Stand gebraucht - die
Nationsuniversität repräsentierte ebensowenig wie die ungarischen
Adelskongregationen die Hörigen gleicher Sprach- bzw.
Volkszugehörigkeit. Ebenso wie die ungarischen oder die rumänischen
Hörigen (die übrigens schon damals die Bevölkerungsmehrheit in
Siebenbürgen bildeten), waren die auf Adelsboden lebenden Deutschen in
Siebenbürgen durch die Nationsuniversität nicht vertreten.
Dieser unter "Nationsuniversität" subsummierte Nationsbegriff ist
also primär nicht Ausdruck einer Volks-, sondern einer
Standeszugehörigkeit, als Nebenprodukt verfassungsgeschichtlicher
Abläufe das Ergebnis des bewußten Strebens nach Zusammenschluß
und Verteidigung von Rechtspositionen einer privilegierten Gruppe. Insoweit
weist die Nationsuniversität auch über den Rahmen der
mittelalterlichen Universitäts- oder Konzilsnationen hinaus
(siebenbürgisch-sächsische Studierende hatten überhaupt keine
Hemmungen, sich nach dem Territorialitätsprinzip der "natio Hungarica"
anzuschließen). Sie bewährte sich deshalb in der frühen
Neuzeit.
4. Frühe Neuzeit: Fürstentum Siebenbürgen
Diese setzte im mittelalterlichen Königreich Ungarn mit einer
Katastrophe ein: 1526 wurde das Reich von Sultan Sülejman dem
Prächtigen bei Mohács vernichtend geschlagen, König Ludwig II.
fiel in der Schlacht. Aufgrund von Erb- und Eheverträgen stand die Krone
Ungarns nun den Habsburgern zu, doch konnten sie ihre Ansprüche nur in
West- und Nordostungarn durchsetzen, während Mittelungarn von den Osmanen
besetzt und 1541 in ein Paschalyk (eine türkische Provinz) umgewandelt
wurde, Siebenbürgen aber sich zu einem autonomen Fürstentum
entwickelte, das die osmanische Oberherrschaft anerkannte.
In diesem Fürstentum kam den drei privilegierten Ständen des
ungarischen Adels, der freien Sekler und Sachsen eine entscheidende Rolle zu:
Sie waren im Landtag vertreten, wo sie über das sog. Kuriatvotum über
ein Vetorecht verfügten und somit Gesetze blockieren konnten, die den
Partikularinteressen des jeweiligen Standes zuwiderliefen; sie wählten den
Fürsten und ernannten die Ratgeber des Fürsten, der dem ungarischen
Adel entstammte. In die eigenen Angelegenheiten einer Nation durften sich weder
die beiden anderen Stände, noch der Landesfürst einmischen. Nicht zu
Unrecht wird darum diese Periode als eine Blütezeit der ständischen
Selbstverwaltung der Siebenbürger Sachsen angesehen.
Weniger erfreulich verlief die politische und wirtschaftliche
Entwicklung. Siebenbürgen wurde im 16.-17. Jahrhundert in das
säkulare Ringen zwischen Habsburgern und Osmanen hineingerissen. Die
österreichische Dynastie gab ihre Ansprüche auf das strategisch
wichtige Siebenbürgen nicht auf, doch fehlte ihr vorerst die Kraft, diese
auch durchzusetzen. Der ungarische Adel widersetzte sich diesen
Ansprüchen, die Siebenbürger Sachsen befürworteten ihn, aus
Verbundenheit zu einem deutschen Herrscherhaus und in der Hoffnung auf
westliche Unterstützung gegen die Türken. "Möge Gott uns
Frieden geben unter unserem deutschen König" schreibt der aus
Nürnberg stammende Hermannstädter Bürgermeister Petrus Haller im
Jahre 1551. Dieser Ausspruch deutet auf eine emotionale Komponente des
Selbstverständnisses hin, das die Siebenbürger Sachsen im Zeitalter
des Humanismus und der Reformation entwickelt haben. Zu den Autostereotypen vom
freien, privilegierten Stand und vom Schutzschild der Christenheit gesellt sich
jener von der deutschen Volkszugehörigkeit.
Das hängt mit der kirchlichen Erneuerung bei den Siebenbürger
Sachsen in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts zusammen. Ein
Kronstädter Ratsherr, Johannes Honterus, der in Wien studiert und sich in
Krakau und Basel als Buchdrucker und Humanist betätigt hatte, betrieb sie
im geistig/geistlichen Bereich im Sinne Martin Luthers und verfaßte ein
Reformationsbüchlein, das der Hermannstädter Bürgermeister Peter
Haller nach einer gewissen Umarbeitung als "Kirchenordnung aller Deutschen in
Sybembürgen" drucken ließ und im weltlich/politischen Bereich
durchsetzte. 1550 beschloß die Nationsuniversität, diese
Kirchenordnung in allen Städten und Gemeinden des Sachsenlandes
einzuführen. Damit schufen sich die Siebenbürger Sachsen eine sog.
geistliche Universität, eine Volkskirche, der im Laufe der Zeit auch
wichtige weltliche Aufgaben in diesem christlich geprägten
Genossenschaftswesen zufallen sollte, die "ecclesia Dei nationis Saxonica".
Den Bestimmungen der Kirchenordnung entsprechend wurde das Schulwesen in
Stadt und Land neu organisiert, ebenso die Armen- und Krankenfürsorge.
Absolventen der Gymnasien wurden nun mit Stipendien auf protestantische
Universitäten in Deutschland geschickt, der über Jahrhunderte in
Handwerk, Handel und Bildung gepflegte Kontakt zum "Mutterland" wurde im
Bereich des Hochschulbesuchs sozusagen institutionalisiert.
In Kirche und Schule wurde nunmehr deutsch gesprochen und das Augsburger
Bekenntnis hochgehalten, während die Ungarn und Sekler reformiert oder
katholisch waren und die Rumänen griechisch-orthodox blieben. Glaube und
Volkstum wurde auf diese Weise zu Synonymen, wobei man sich aber bereits 1557
auf Initiative der Sächsischen Nationsuniversität erstmals in Europa
auch zur religiösen Toleranz durchzuringen vermochte, nämlich
"daß jeder den Glauben behalten könne, den er wolle, mit neuen
und alten gottesdienstlichen Gebräuchen und in Sachen des Glaubens ihrem
Gutdünken überlassen, daß geschehe was ihnen beliebt, jedoch
ohne Beleidigung irgendjemandes". Evangelisch-lutherisches Bekenntnis, bei
Duldung anderer Konfessionen, wurde damit zu einer weiteren und wesentlichen
Komponente siebenbürgisch-sächsischen Selbstverständnisses.
1583 faßte die Nationsuniversität die überlieferten
Rechtsgewohnheiten zusammen, ergänzte sie mit Klauseln des römischen
Rechts und ließ sie vom Landesherren, dem Fürsten Stephan
Báthory, der damals auch polnischer König war, bestätigen:
"Der Sachsen in Siebenbürgen Statuta oder eygen Landrecht". Das
Gesetzbuch, das allen Mitgliedern der Nationsuniversität persönliche
Freiheit, Eigentumsrecht und Rechtsgleichheit zusprach, blieb bis 1853 in
Gebrauch. Die Gleichheit vor dem Gesetz, die darin zum Ausdruck kommt,
entsprach allerdings nicht voll den Tatsachen, denn soziale Unterschiede gab es
selbstverständlich auch in der siebenbbürgisch-sächsischen
Gesellschaft, Konflikte zwischen Patriziat und Unterschichten wurden im 17.
Jahrhundert besonders virulent. Im Bewußtsein der Gruppe hat sich
hingegen - auch unter dem Einfluß ihrer Historiker - der Topos von einer
Gesellschaft durchgesetzt, "da keiner Herr und keiner Knecht", von einer
jahrhundertealten Demokratie, die auf Wahl der politischen und kirchlichen
Repräsentanten gründete. Diese Komponente des
siebenbürgisch-sächsischen Selbstverständnisses ignoriert die
sozialen Strukturen ebenso wie den Umstand, daß nur Besitzende
wählbar waren oder daß die siebenbürgisch-sächsischen
Hörigen an dieser Art der Demokratie keinen Anteil hatten, ebensowenig wie
die untertanen Rumänen, die sich auf Königsboden niedergelassen
haben.
Das im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, in einem
mitbestimmten siebenbürgischen Ständefürstentum entwickelte neue
Selbstbewußtsein findet seinen Ausdruck in einer Rede, die der
Sachsengraf Albert Huet 1591 vor dem siebenbürgischen Fürsten
gehalten hat, der "Grundausführlichen Sermon von der Sachsen Ursprung,
Leben, Handel und Wandel".
Sie war als Verteidigungsrede der sächsischen Privilegien
konzipiert, die der ungarische Adel unter Hinweis auf die fremde Herkunft und
den niederen Stand der deutschen Bauern und Handwerker in Frage gestellt hatte.
Dem hielt Huet entgegen, diese seien von König Geisa "geladen und
gebeten" und hätten "nach solcher Besitzung des Landes so lange
gestritten und Krieg geführt, bis ihre Schwerter und Spieße zu
Pflugeisen verwandelt worden". Als Bauern, Handwerker und Kaufleute
hätten sie sich "ehrlich ernähret ... und zur Not dem König
und dem Land einen dicken, fetten, guten und angenehmen Zins geben
können", der weitaus größer sei, als jener der anderen
Nationen. Zudem seien "die Sachsen das dritte Teil (=Stand) des
Landes und gebrauchten sich einer freien Stimme in Erwählung des
Fürstenund allen gemeinen Händeln". "Darum" - meint Huet
selbstbewußt - "sind wir nun nicht mehr Fremdlinge, sondern
bekräftigte Bürger und Einheimische des Landes".
5. Provinz des Habsburgerreiches
Aus dem Ringen zwischen Habsburgern und Osmanen ist am Ende des 17.
Jahrhunderts - nach Abwehr der türkischen Belagerung von Wien (1683) und
nach mehrjährigen Kämpfen unter Feldherren wie Herzog Karl von
Lothringen, Markgraf Ludwig von Baden (dem "Türkenlouis") und Prinz Eugen
von Savoyen ("dem edlen Ritter") - eine neue, abendländisch orientierte
Großmacht in Mittel- und Südosteuropa hervorgegangen, die
habsburgische Donaumonarchie.
Der Erwerb Siebenbürgens war dabei für die Habsburger von
großer strategischer und politischer Bedeutung, wie einer Denkschrift des
kaiserlichen Generals Caraffa zu entnehmen ist: "Das Fürstentum ist von
der Natur zur Citadell angelegt, von welcher aus alles, was zwischen Donau,
Mähren, dem schlesischen und polnischen Gebirge lieget, dominiert und im
Zaum gehalten werden kann". Als Grundkraft und Zierde Siebenbürgens
("nervus ac decus Transilvaniae") wird dessen deutsche Bevölkerung
bezeichnet, "diese redliche und wohlintentionierte Nation", zumal das
Land sonst "dem Haus Österreich gegenüber von jeher
aufsässig" gewesen sei.
Doch auch die Sachsen begegneten den Habsburgern mit einer gewissen
Skepsis: Sie fürchteten sich vor der zügellosen Soldateska, vor neuen
Abgaben und Steuern, vor dem gegenreformatorischen Eifer des Kaisers, sie
wollten ihren in anderthalb Jahrhunderten ausgebauten Status eines dritten, das
Schicksal des Landes mitbestimmenden Standes nicht gefährden. Der sog.
Schusteraufstand in Kronstadt (1688) ist aus dieser antihabsburgischen Stimmung
heraus ausgebrochen.
Die führenden Politiker der Siebenbürger Sachsen aber - so ihr
Komes Valentin Frank (später mit dem Prädikat "von Frankenstein"
geadelt) und ihr Provinzialnotar Johannes Zabanius (später "Sachs von
Harteneck") wirkten für das deutsche Kaiserhaus und handelten, zusammen
mit Vertretern der beiden anderen Stände, das sog. Leopoldinische Diplom
von 1691 aus, das die geltende Landesverfassung und damit die Vorrechte der
drei ständischen Nationen und die Religionsfreiheit bestätigte.
Dieses Diplom blieb bis 1848 sozusagen das Grundgesetz von Siebenbürgen.
Der Friede von Karlowitz (1699) bestätigte die habsburgischen
Neuerwerbungen. Siebenbürgen wurde aus dem türkisch-balkanischen
Machtbereich entlassen und gehörte nunmehr wieder zu Mitteleuropa.
Es folgte die stufenweise Eingliederung in den Gesamtkomplex der
habsburgischen Länder, im Sinne des vereinheitlichenden Absolutismus jener
Zeit. Gegen den Partikularismus der Stände, die eifersüchtig auf
Wahrung ihrer Privilegien achteten, setzte sich der Zentralismus des Wiener
Hofes durch.
Die Siebenbürger Sachsen mußten dabei an mehreren Fronten
kämpfen:
- der katholische Kaiser wollte ihre evangelische Volkskirche
schwächen und ihre ständische Sonderstellung beseitigen, bis hin zur
Zerschlagung der Nationsuniversität; vor allem in den ersten Jahren
belastete er sie mit ungeheuren Kontributionen;
- der ungarische Adel bedrohte ihre Rechtslage und Fiskalautonomie,
weil er sich auf Königsboden niederlassen, dort aber keine Abgaben
entrichten wollte;
- die Rumänen, deren Zahl im 17. Jahrhundert jäh angestiegen
war, als sie sich in durch Kriege und Seuchen leer gewordenen sächsischen
Dörfern niedergelassen hatten, beanspruchten nun das Bürgerrecht und
ließen damit Überfremdungsängste aufkeimen.
Das Siebenbürger Deutschtum muß also einerseits den schweren
Weg von der ständischen Nation, die weitgehend ihr Schicksal selbst
bestimmt hatte, zur nationalen Minderheit beschreiten; andererseits aber wird
es auch gestärkt, weil es wieder in enge Verbindung zum Reich treten kann.
Zudem garantiert die Eingliederung in ein gut organisiertes Staatswesen
für lange Zeit Frieden und geordnete Verhältnisse, so daß sich
die wirtschaftliche Lage stabilisieren kann.
In dieser Zeit des Übergangs wächst Johannes Zabanius Sachs
von Harteneck (1664-1703) zur genialen politischen Persönlichkeit der
Siebenbürer Sachsen heran. Obwohl er als Kind im slowakischen Preschau
unter der habsburgischen Gegenreformation gelitten hat (sein Vater mußte
nach Hermannstadt fliehen, wo er später Stadtpfarrer wurde), setzt
Zabanius früh und eindeutig auf die kaiserliche Karte, von der er nicht
nur den Wiederanschluß Siebenbürgens an das Abendland, sondern auch
eine Verbesserung der staatspolitischen Stellung der Sachsen unter einem - wie
er formuliert - "angestammten Herrscherhaus" erwartet. Er sieht in diesem einen
natürlichen Verbündeten gegen die Arroganz, die Ansprüche und
die Privilegien des ungarischen Adels. Den bereits im 16. Jahrhundert
angemeldeten Anspruch auf Haus- und Grundbesitzerwerb in sächsischen
Städten, der mit der Weigerung verbunden war, sich an den städtischen
Abgaben zu beteiligen (da Adlige keine Steuern entrichteten) empfindet er als
Gefahr für Recht und Gut seiner Mitbürger. Mit Argumenten, die sich
an jene von Albert Huet anlehnen, weist er die Anmaßungen zurück,
geht aber weiter und fordert in einem Steuerreform-Entwurf die gerechtere
Verteilung der Lasten auf alle Bewohner des Landes, den Adel nicht ausgenommen,
also Steuergleichheit. Damit ist er seiner Zeit weit voraus und das rächt
sich: Er fällt einem Intrigenspiel zum Opfer und wird 1703 hingerichtet.
"Fidem genusque servabo" - ich diene meinem Glauben und meinem Volk -
ist der Wahlspruch jenes Siebenbürger Sachsen, der es in der Hierarchie
des österreichischen Staates am weitesten gebracht hat: Samuel von
Brukenthal. Ihm ist es gelungen, unter einer "allerkatholischen Majestät"
wie Maria Theresia (1740-1780) und in einer Zeit katholischen Proselytentums,
des Glaubenswechsels aus Karrieregründen, Gouverneur von Siebenbürgen
(1774-1787) zu werden, ohne sich selbst zu verleugnen. Er verbindet
selbstbewußt und geschmeidig den treuen Dienst für das Herrscherhaus
mit der Interessenvertretung seiner Mitbürger. Er schützt deren
lutherische Volkskirche, wehrt Angriffe auf ihre privilegierte Rechtsstellung
ab und versucht, sie vor Überfremdung zu bewahren.
In seiner Argumentation gegen die Gewährung des Bürgerrechts
auf Sachsenboden an ungarische Adlige oder rumänische Untertanen preist
Brukenthal die Rechtslgleichheit und das Gemeinschaftsbewußtsein der
Mitglieder der Sächsischen Nationsuniversität und bündelt die
Komponeneten des damaligen Selbstverständnisses der Siebenbürger
Sachsen in den Sätzen: "Kein Magnat oder Edelmann ist in der
Sächischen Nation frei, alle zahlen nach ihrer Habschaft, nach Grund- und
Bodenbesitz und allem, was sie haben. Sie tragen die gemeinen Lasten
gemeinschaftlich, stellen ihren Anteil an der Kriegsmannschaft. Kein Einzelner
darf die Gerechtigkeitspflege ausüben, nur gewählte
Communitäten, die sie vertreten und das ganze Volk vorstellen". Er
weist seine Kaiserin auf das Deutschtum ihrer Untertanen hin , die sich
"seit sie aus ihrem Vaterlande, den deutschen Provinzen berufen worden,
niemals vermischt" hätten (das hat mir übrigens noch meine
Großmutter seit der Pubertät eingehämmert: "Vermisch Dich nicht
mit anderen, heirate eine Sächsin!"). Schließlich schildert
Brukenthal der Kaiserin die drohende Gefahr: "Anstatt ein einzelnes
bestimmtes Individuum zu sein, würde er das Gemisch von vielen werden,
und, ohne die Tugend des Volkes, von dem er abstammt zu besitzen, würde er
seine Fehler und die Gebrechen aller an sich haben, mit denen er vermengt sein
würde" (das klingt für unsere Ohren schon fast rassistisch, wurde
aber unter anderen Voraussetzungen, zu einer anderen Zeit, nämlich im 18.
Jahrhundert geschrieben).
Mit seinen Reformen, die eigentlich einen modernen Einheitsstaat mit
einer zusammenwachsenden "natio austriaca" gleichberechtigter Bürger
schaffen wollte, hatte Kaiser Josef II. (1780-1790) eine Lawine losgetreten,
die dem Vielvölkerstaat zum Verhängnis werden sollte: Er wandte sich
"an meine Völker" und wollte aus ihnen ein Volk machen; diese ordneten
sich aber nicht einer gemeinsamen Staatsidee unter, sondern entwickelten ein
eigenes Nationalbewußtsein. Der Nationalismus wurde zum beherrschenden
Thema der folgenden Jahrhunderte.
Josefs Maßnahmen, die den ständischen Partikularismus in
Siebenbürgen beseitigen wollten, trafen vor allem jenen der
Siebenbürger Sachsen. Überzeugt davon, daß die
"Difficultäten zwischen den Nationen nicht aufhören, wenn nicht
alle Siebenbürger werden" (womit er bis heute Recht behalten hat),
setzte Josef das Leopoldinische Diplom außer Kraft. Er löste die
Sächsische Nationsuniversität auf und öffnete mitd em
Konzivilitätsreskript Schleusen: Ungarn und Rumänen konnten sich nun
auf Sachsenboden niederlassen und wurden "in allen Rechten
gleichgehalten", Garantien für die Fortdauer einer Gruppe, die nur 10%
der Landesbevölkerung ausmachte, wurden aber nicht gegeben. Josef II.
widerrief zwar, wie bekannt, seine "Revolution von oben", ihre Wirkungen
konnten jedoch nicht einfach rückgängig gemacht werden. Den
Siebenbürger Sachsen zeichneten sie die Zukunft vor: die Existenz als
nationale Minderheit unter dem Druck eines fremden Nationalismus - des
ungarischen im 19. und des rumänischen im 20. Jahrhundert. Sie waren nicht
mehr eine der drei tragenden Säulen der ständestaatlichen Verfassung,
ihre mittelalterlichen Privilegien waren auf Dauer nicht zu halten. Ihre
Existenzberechtigung leiteten sie zunehmend aus der Wirtschaftskraft, aus einem
wachsenden deutschen Selbstbewußtsein und vor allem aus kulturellen
Leistungen ab.
Auf Brukenthal und Josef II. sowie auf deren Zeit folgten die sog.
"stillen Jahre". Eine "sächsische Gewohnheitsaristokratie", vom
Metternichschen System gefördert, stellte sich einer geistigen und
wirtschaftlichen Erneuereung in den Weg. Erst im Vormärz lockerten sich
diese verkrusteten Strukturen. Sparkassen wurden gegründet, die dem
Kapitalmangel in Gewerbe und Handel behelfen wollten. Landwirtschafts- und
Gewerbevereine ermöglichten die Einführung neuer Technologien. Im
wissenschaftlichen Bereich schuf der 1840 gegründete Verein für
siebenbürgische Landeskunde den Rahmen für intensivere Forschungen.
Er stand "jeder Nation und jedem Stand" offen - ein Novum. Wie in ihrer
damals entstandenen Volkshymne, die Siebenbürgen als "Land des Segens"
pries, um dessen Söhne sich "der Eintracht Band" schlingen solle,
versuchten die Sachsen sich in einer nationalistisch geprägten Zeit als
ausgleichendes Element im nun ausbrechenden ungarisch-rumänischen Konflikt
zu profilieren.
Während der Revolution von 1848/49 sind solche auf Ausgleich
pochende Stimmen nicht gefragt. Ihr profiliertester Wortführer, der
Pfarrer Stephan Ludwig Roth, wird von ungarischen Revolutionären
hingerichtet, nicht zuletzt weil er darauf hingewirkt hat, daß die
Sächsische Nationsuniversität am 3. April 1848 die volle
Gleichberechtigung der auf ihrem Gebiet wohnenden Rumänen beschloß.
Hauptthema war nun die Vereinigung Siebenbürgens mit dem von
Habsburg abgefallenen Ungarn des Revolutionsführers Lajos Kossuth. Ihr
widersetzten sich die Siebenbürger Sachsen und die Rumänen. Beide
orientierten sich nun auf ein Staatsvolk, das außerhalb der
österreichischen oder ungarischen Grenzen lag: Die Rumänen denken an
die Vereinigung Siebenbürgens mit der Moldau und der Walachei zu einem
rumänischen Staat, die Sachsen aber, vor allem ihre Jugendlichen,
schwärmen für die Frankfurter Nationalversammlung. Ihr schreiben sie:
"Alle Welt ist deutscher Kinder voll. Auch wir sind Sprößlinge
dieser Wurzeln. Geographisch getrennt und auf der Oberfläche des Bodens
ohne sichtbare Berührung mit dem Mutterlande leben wir doch durch die
Presse, durch die Universitäten, durch Wanderungen unserer Gewerbsleute,
durch Erinnerungen der Vergangenheit und Hoffnungen der Zukunft mit und durch
Deutschland ... Wir sind stark, wenn Deutschland es ist ... Wir wollen sein und
bleiben, was wir immer gewesen sind, ein ehrlich deutsches Volk und auch
ehrliche treue Bürger desjenigen Staates, dem wir angehören".
Dieses Bekenntnis zum Deutschtum, verbunden mit dem Bekenntnis zu dem
Staat, in dem sie leben, beherrscht die nächsten hundert Jahre der
siebenbürgisch-sächsischen Geschichte. Es hilft zunächst, die
Folgen des österreichisch-ungarischen Ausgleichs (1867) zu tragen: die
Eingliederung Siebenbürgens in den ungarischen Teil der nunmehrigen
Doppelmonarchie, den weitgehenden Verlust der politischen Mitsprache und die
plötzliche Realität, eine Minderheit zu sein, deren Vertretung, die
Nationsuniversität, 1876 aufgelöst wird, den wachsenden
Magyarisierungsdruck, die Enttäuschung über das habsburgische
Herrscherhaus. Das Bismarckreich von 1871 zieht die Sachsen in seinen Bann und
wird von ihnen idealisiert.
An die Stelle der aufgelösten Nationsuniversität tritt die
Volkskirche als Refugium der eigenen Identität. Ihr "Sachsenbischof" wird
zur Integrationsfigur und anerkannten geistlichen wie weltlichen
Autorität. Kirchenführer wie die Bischöfe Teutsch (1817-1893)
und sein Sohn Friedrich (1852-1933) schaffen innerhalb der Kirche Nischen, in
denen der Magyarisierung widerstanden werden kann. Die evangelisch-lutherische
Kirche wird zur Kirche der Deutschen in Siebenbürgen schlechthin: Hier
wird weiterhin deutsch gepredigt, das konfessionelle und damit dem staatlichen
Zugriff weitgehend entzogene Schulwesen wird ausgebaut, die deutsche
Unterrichtssprache kann beibehalten werden. Als Ersatz für den verlorenen
politischen Status bieten die beiden Teutsch mit ihrer vierbändigen
"Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk"
einen zum Teil verherrlichenden Rückblick auf die glorreiche Vergangenheit
und stärken damit das Selbstbewußtsein ihrer Landsleute. Das
ausgeprägte Geschichtsbewußtsein, das die Siebenbürger Sachsen
bis heute kennzeichnet, geht auf ihr Wirken zurück. Im Unterschied zu
anderen Bevölkerungsgruppen aus Transsylvanien, deren Elite in der
ungarischen Politik und Kultur aufgeht, widerstehen die Siebenbürger
Sachsen der Magyarisierung.
6. Teil des Königreiches Großrumänien
Als der österreichisch-ungarische Vielvölkerstaat als Folge
des Ersten Weltkrieges in mehrere Nationalstaaten zerfiel, wobei
Siebenbürgen dem altrumänischen Königreich angeschlossen wurde,
fiel es den Siebenbürger Sachsen nicht besonders schwer, dieser
Entwicklung zuzustimmen, zumal die Rumänen am 1. Dezember 1918 in
Karlsburg "die volle nationale Freiheit für die mitwohnenden
Völker" zugesagt hatten. Der Vertrag von Trianon (1920) trug dieser
Zustimmung Rechnung und sanktionierte die Vereinigung Siebenbürgens mit
Rumänien. Auch der Minderheitenschutz (Gleichberechtigung, kirchliche und
kulturelle Autonomie, politische Repräsentation, Gebrauch der
Muttersprache und eigenes Schulwesen) wurden vertraglich abgesichert.
In der Praxis wurden diese Zusagen nie widerrufen, aber auch fast gar
nicht angewandt. Die neue Verfassung von 1923 beachtete sie kaum, die
Agrarreform traf vor allem die sächsischen Körperschaften: Die Kirche
verlor etwa 55% ihres Grundbesitzes, die Gemeinden über 50% der
Gemeinerde, die Stiftung "Sächsische Nationsuniversität", die nach
1876, der Auflösung der gleichnamigen Institution, den sächsischen
Gemeinbesitz verwaltet und die Erträge vorrangig für das
deutschsprachige Schulwesen zur Verfügung gestellt hatte, verlor
große Teile ihres Grundbesitzes. Schulgesetze bedrohten das
eigenständige Unterrichtswesen, kleinliche Schikanen der Behörden
gesellten sich dazu; die neue, vor allem aus dem rumänischen Altreich
rekrutierte und sich am französischen Zentralstaat orientierende
Führungsschicht brachte für die nationale Frage kein Verständnis
auf.
Die Politiker der rund 250 000 Siebenbürger Sachsen wirkten deshalb
für den Zusammenschluß mit den anderen deutschen
Siedlergemeinschaften des Landes (den Banater Schwaben, den Bukowina- und
Bessarabiendeutschen u.a., zusammen fast 800 000 Bürger) zum Verband der
Deutschen in Rumänien. Zugleich wurden sie in der internationalen
Minderheitenbewegung aktiv. Wesentliche Verbesserungen konnten jedoch nicht
durchgesetzt werden und die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre
vergrößerte die allgemeine Unzufriedenheit.
So konnten auch unter den im Grunde liberal-konservativ eingestellten
Siebenbürger Sachsen radikal-nationale Bewegungen Fuß fassen, die
nach 1933 zunehmend in den Sog der nationalsozialistischen Volkstumspolitik
Hitlers gerieten. Das wirkte sich verheerend aus. Der vermeintliche nationale
Höhenflug in der Zeit des Nationalsozialismus sollte das Ende eines
geschichtlich gewachsenen Eigenlebens einläuten. De Siebenbürger
Sachsen wurden in eine Globalstrategie einbezogen, die die "Deutsche
Volksgruppe in Rumänien" als Hebel benutzte, um das Land dem deutschen
Einflußbereich einzuverleiben. Dem "sächsischen"
Selbstverständnis wurde "deutsches" Sendungsbewußtsein aufgepfropft,
die alte politische Klasse entmachtet, gleichgeschaltet oder durch Personen
ersetzt, die von reichsdeutschen Parteistellen gelenkt wurden. Die Schulen
wurden der kirchlichen Obhut entzogen, die Kirchenführung ausgewechselt.
Der sog. 2. Wiener Schiedsspruch, unter maßgeblicher Beteiligung der
deutschen Reichsregierung zustandegekommen, riß die Siebenbürger
Sachsen erstmals in ihrer Geschichte politisch-territorial auseinander:
Nordsiebenbürgen wurde Ungarn zugesprochen, Südsiebenbürgen
verblieb bei Rumänien. Immer offener mischte sich die deutsche
Reichsführung in die Angelegenheiten der Volksgruppe ein, bis hin zu einem
zwischenstaatlichen Abkommen mit Rumänien, das den Kriegsdienst
rumänischer Staatsbürger deutscher Herkunft in der Wehrmacht bzw. in
der Waffen-SS vorsah (1943). So kam es, daß die Siebenbürger Sachsen
während des II. Weltkrieges in drei Heeren dienten, die älteren
Südsiebenbürger im rumänischen, die jüngeren im deutschen,
die älteren Nordsiebenbürger im ungarischen, die jüngeren im
deutschen. In allen drei wurden sie Opfer eines sinnlosen und verbrecherischen
Krieges, oft, leider, auch Täter.
Das Ergebnis dieses Krieges ist bekannt. Am 23. August 1944 schloß
Rumänien im Angesicht der vormarschierenden Sowjetarmee einen
Waffenstillstand ab und erklärte kurz danach seinem bisherigen
Verbündeten den Krieg. In Nordsiebenbürgen erkannte der deutsche
General Artur Phleps, ein Siebenbürger Sachse, daß die Situation
aussichtslos und für seine Landsleute gefährlich war; er ordnete die
Evakuierung der Deutschen aus dem Nösnerland an. In Trecks zogen sie nach
Österreich, viele sind später nach Nordrhein-Westfalen
übersiedelt, wo sie heute noch leben. In Südsiebenbürgen konnte
ein ähnlicher Plan nicht mehr durchgeführt werden. Anfang September
1944 besetzten sowjetische Truppen Hermannstadt.
7. Unter kommunistischer Herrschaft. Ausklang einer jahrhundertealten
Geschichte
Unter dem Druck der sowjetischen Truppen erfolgte die stufenweise
Machtübernahme durch die Kommunisten in Rumänien. Im März 1945
wurde eine kommunistische Regierung eingesetzt, im Dezember 1947 mußte
König Michael von Hohenzollern das Land verlassen. Roter Terror
überzog das Land: Bürgerliche Politiker und Intellektuelle wurden
interniert, politische Parteien verboten, die Wirtschaft verstaatlicht, die
konfessionellen und privaten Schulen aufgelöst, die Sozialisierung der
Landwirtschaft eingeleitet.
Die Deutschen des Landes wurden - obwohl sie kaum Schuld am
Kriegsgeschehen traf - in eine Art nationale Sippenhaft genommen. Im Januar
1945 erfolgte die Deportation der arbeitsfähigen Männer und Frauen
zum Wiederaufbau in die Sowjetunion, unter ihnen etwa 30 000 Siebenbürger
Sachsen. Sie wurden durch Hunger, Kälte und Seuchen dezimiert, etwa ein
Drittel starb eines elenden Todes; die Überlebenden schufteten z. T. bis
1952 in den Kohlebecken Rußlands, und der Rücktransport eines guten
Teils erfolgte nicht in die Heimat, sondern in die sowjetische Besatzungszone
Deutschlands und wurden so für Jahre und Jahrzehnte von ihren Familien
getrennt.
In Siebenbürgen blieben die Sachsen jahrelang politisch rechtlos
und waren als "Hitleristen" der behördlichen Willkür ausgesetzt.
Durch die Agrarreform von 1945 wurden etwa 60 000 sächsische Bauern
enteignet. Sie mußten ihre Höfe verlassen, die ihnen erst 1956 -
inzwischen völlig verwahrlost - zurückgegeben wurden. In den
Städten wurden nicht nur die Großbetriebe und Banken verstaatlicht,
sondern auch die kleinen Handwerker und Kaufleute enteignet, ihre Häuser
wechselten den Besitzer. Vom Genuß der 1945 zugesagten Minderheitenrechte
wurden sie ausdrücklich ausgeschlossen, auch das Wahlrecht wurde ihnen
aberkannt. Nur die in anderen Ländern Osteuropas vorgenommene Vertreibung
und Racheakte des Staatsvolks, mit dem sie jahrhundertelang friedlich
zusammengelebt hatte, blieben den Siebenbürger Sachsen erspart.
Die evangelische Kirche durfte fortbestehen; sie blieb in den schweren
Jahren der kommunistischen Diktatur die halbwegs intakte Einrichtung der
Siebenbürger Sachsen, ihr letztes Refugium. Ab 1949 wurden auch die
Maßnahmen gegen die Deutschen allmählich gelockert. Staatliche
deutsche Schulen, eine deutsche Zeitung, ein Theater wurden zugelassen. 1956
wurde ihnen der Minderheitenstatus zuerkannt und die Bauernhäuser oder
Wohnungen zurückerstattet.
Trotzdem erfolgte eine radikale Veränderung der
sozio-ökonomischen Schichtung: Bis 1945 waren etwa 85% der
Rumäniendeutschen als Selbständige tätig, darunter 70% als
Bauern. Nach knapp einem Jahrzehnt, 1956, wies die erste Volks- und
Berufszählung im kommunistischen Rumänien nur noch 22% in der
Landwirtschaft tätige Deutsche aus, die nun in den neuen, unrentablen LPG
arbeiteten. Viele wurden zu Industriearbeitern,
unverhältnismäßig hoch ist die Zahl deutscher
Hochschulabsolventen. Viele nun besitzlose Eltern opferten sich auf, um ihren
Kindern ein Studium zu ermöglichen. Doch auch diese einzige Mitgift, die
sie geben konnten, erwies sich als zwiespältig, denn gerade Intellektuelle
wurden im Kommunismus besonders verfolgt. Ein Hinweis auf den
Schriftstellerprozeß oder auf die Verurteilung deutsche Studenten Mitte
der fünfziger Jahre kann das belegen.
Enteignung und Industrialisierung haben die Bindung an den heimatlichen
Boden zunehmend gelockert und das Verhältnis zum rumänischen Staat
nachhaltig zerrüttet, allerdings nicht jenes zum rumänischen Volk,
das sich in all den Jahren weitgehend tolerant und korrekt verhalten hat.
Versuche des kommunistischen Staates, wieder Vertrauen zu schaffen, blieben
fruchtlos. So gab Nicolae Ceausescu in seiner "Reformphase" der sechziger Jahre
frühere Fehler offen zu und ließ einen Rat der Werktätigen
deutscher Nationalität gründen, der die Minderheit vertreten sollte.
Die spätere Minderheitenpolitik des Diktators bestätigte aber das
Mißtrauen, das man diesen Versuchen entgegenbrachte. Er sprach bald offen
davon, daß er eine einheitliche rumänische, überdies
sozialistische Nation zu schaffen gedenke. Der Gebrauch deutscher Ortsnamen
wurde verboten, die geschichtlichen Leistungen weitgehend verschwiegen. Ein
Gesetz über den Schutz nationalen Kulturguts proklamierte ein Obereigentum
des Staates über jeglichen Besitz, private Bücher oder Möbel
nicht ausgenommen. Die immer unerträglicher werdende Diktatur mit ihrem
Büttel- und Spitzelapparat verstärkte die Sehnsucht nach Freiheit.
Und auch das Streben nach wirtschaftlicher Verwirklichung ist legitim.
All diese Faktoren erklären den Wunsch der meisten
Siebenbürger Sachsen, ihre Heimat zu verlassen. Zunächst ging es um
die Zusammenführung der im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit
auseinandergerissenen Familien. Wehrmachtsangehörige, die nach dem Krieg
nicht mehr zurückkehren konnten, in die Sowjetunion Deportierte, die in
Frankfurt an der Oder freigelassen wurden, suchten ihre Angehörigen. Sieht
man von der einmaligen Aktion des Roten Kreuzes im Jahr 1951 ab, dank der rund
tausend Rumäniendeutsche nach Deutschland gelangten konnten, erlaubte das
kommunistische Regime erst ab 1958 einer nennenswerten Anzahl Siebenbürger
Sachsen und Banater Schwaben die Ausreise. Sie zogen ihrerseits Angehörige
nach. Verwandtenbesuche - nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik und Rumänien möglich - verstärkten die
Sogwirkung.
Für die Familienzusammenführung entwickelte sich ein
"geregeltes Verfahren", in dem materielle Interessen des rumänischen
Staates eine nicht unbedeutende Rolle spielten. Eine Beschleunigung der
Ausreise, die aber immer noch mit vielerlei Schikanen verbunden war, brachte
die im Januar 1978 zwischen Bundeskanzler Schmidt und dem rumänischen
Diktator abgeschlossene Vereinbarung über die erweiterte
Familienzusammenführung, die jährlich etwa 11 000
Rumäniendeutschen die Aussiedlung ermöglichte. Die Zahl der
Anträge wuchs beständig, ungeachtet der als erniedrigend empfundenen
Festsetzung eines Entgelts für die Ausbildungskosten des rumänischen
Staates, die man als "Kopfgeld" und "Sklavenhandel" bezeichnete (ich habe mir
damals ausgerechnet, daß ein Kilo Konrad Gündisch etwa 110 Mark
kostet).
Bis zum Umbruch in Rumänien im Dezember 1989 sind auf diese Weise
insgesamt 242 326 Deutsche aus Rumänien in die Bundesrepublik gekommen,
davon etwa die Hälfte Siebenbürger Sachsen. Schon während der
letzten Jahre vereinsamten die Zurückgebliebenen. Verwandte, Freunde,
Nachbarn fehlten, Kindergärten und Schulen mußten wegen fehlender
Schüler geschlossen werden. Nur noch 96 000 Siebenbürger Sachsen
erlebten in Rumänien den Sturz des Diktators. Als danach die Grenzen
geöffnet wurden, gab es kein Halten mehr. In kürzester Zeit
schrumpfte die Zahl der in der Heimat verbliebenen Sachsen auf etwa 25 000. Sie
leben verstreut in 266 Gemeinden, darunter 67 mit 20-50 und 64 mit weniger als
20 evangelischen Gemeindemitgliedern. Zusammenhalt bietet neben der Kirche das
Ende 1989 gegründete Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien,
das auch im neuen rumänischen Parlament vertreten ist und - mit
Unterstützung durch die deutsche Regierung - zahlreiche Maßnahmen
zur Stabilisierung der deutschen Bevölkerung des Landes in die Wege
geleitet hat, im wirtschaftlichem wie im kulturellen Bereich, besonders im
deutschen Schulwesen. Jedoch, die Jugend hat das Land weitgehend verlassen,
aktiv sind in Siebenbürgen die 55-70jährigen. Ein Finis Saxoniae ist
abzusehen.
Die Aussiedler streben in Deutschland nach Integration. Sie wollen, wie
sie es ausdrücken, als "Deutsche unter Deutschen" leben. Die relativ gute
Kenntnis der deutschen Sprache und die gute Berufsausbildung ebnen ihnen diesen
Weg, die eingangs angesprochenen Identitätsfragen sind marginal. In kurzer
Zeit werden sie zu - oft recht erfolgreichen - deutschen Staatsbürgern.
Die Sehnsucht nach der alten Geborgenheit in einer vertrauten und
übersichtlichen Gemeinschaft führt die vornehmlich älteren
Siebenbürger Sachsen in landsmannschaftlichen, kulturellen oder
Heimatortsvereinen zusammen, die Jüngeren passen sich im Alltag und in der
Aussprache schnell an und sind von ihren Mitbürgern nicht mehr zu
unterscheiden. Für sie ist bestenfalls das Interesse an der Herkunft, die
Suche nach den Wurzeln, ein Bindeglied zur Heimat der Väter. Die
Integration erfolgt dabei im Wege der Identifikation mit der eigenen
Vergangenheit, wie das fortbestehende Interesse an Geschichte und Kultur des
Herkunftsgebietes zeigt, das sich in der Abnahme einschlägiger
Geschichtswerke oder in eigenen Schul- oder Hochschularbeiten mit
siebenbürgischer Thematik artikuliert. Ob auf diese Weise die Geschichte
der Siebenbürger Sachsen weitergeht? Sie wird wohl ein Kapitel im Buch der
gesamtdeutschen Geschichte bleiben, mit Stichworten wie "Wehrkirchen", "Mittler
zwischen Ost und West", "Freiheitsliebe" oder "gering an Zahl, nie Staatsvolk,
trotzdem unter wechselnden Regierungen über fast neun Jahrhunderte die
Identität bewahrt".

Fußnote 1
Péter Eszterházy: Donau abwärts. Roman. Aus dem
Ungarischen von Hans Skirecki. Salzburg, Wien 1993, S. 71-72.
Fußnote 2
Kurt Horedt: Das frühmittelalterliche Siebenbürgen. Ein
Überbllick. Thaur/Innsbruck 1988, S. 15.
Fußnote 3
Horedt: a. a. O., S. 83-85, Zitat S. 84.
Fußnote 4
Diplomata Hungariae Antiquissima, vol. I. Budapest 1992, Nr. 73, S. 217f.
Fußnote 5
De institutione morum ad Emericum ducem, ediert von Györffy
György: Wirtschaftund Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendwende.
Wien, Köln, Graz 1983, Zitat S. 259. Deutsche Übersetzung aus: Die
Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog,
bearbeitet von Immo Eberl u. a. Sigmaringen 1989, S. 66.
Fußnote 6
"Hospites cuiuscumque nacionis secundum libertatem ab inicio eis concessam
teneantur." Facsimile und Edition von ÉRSZEGI Géza: Az
aranybulla, (Budapest 1990), Zitat S. 31.
Fußnote 7
Er wurde in der Literatur bisher als Hezelo von Merkstein bezeichnet, vgl.
Karl Kurt KLEIN: Anselm von Braz und Hezelo von Merkstein: die ersten
Siebenbürger Sachsen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 14
(1965), S. 161-168 (Nachdruck in K. K. KLEIN: Saxonica Septemcastrensia,
Marburg 1971, S. 160-167). Walter SCHULLER: ... ein gewisser Hezelo - Miszelle
eines Außenstehenden zu einer kleinen Namenskorrektur. In: Zeitschrift
für Siebenbürgische Landeskunde 17 (1994), S. 67, hat kürzlich
darauf hingewiesen, daß aufgrund der "Annales Rodenses" nur die
Herkunftsbezeichnung "von Angelsdorf" zulässig ist. Jüngst hat Harald
ZIMMERMANN: Die deutsche Südostsiedlung im Mittelalter. In: Günther
SCHÖDL (Hg.): Land an der Donau [Reihe: deutsche Geschichte im Osten
Europas]. Berlin 1995, S. 32, den Namen Hetzelo von Ritzerfeld bei Merkstein in
Umlauf gebracht.
Fußnote 8
Harald ZIMMERMANN: 850 Jahre Siebenbürger Sachsen. In: Zeitschrift
für Siebenbürgische Landeskunde 15 (1992), S. 1-10.
Fußnote 9
Kurt HOREDT: Siebenbürgen im Frühmittelalter, S. 159, registriert
insgesamt fünf Etappen der Inbesitznahme Siebenbürgens durch Ungarn:
"um 900 Linie des Kleinen Somesch, um 1000 Miereschlinie, um 1100 Linie der
Großen Kokel, um 1150 Altlinie und schließlich um 1200 Erreichung
der Karpatengrenze." Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen erfolgte
demnach beginnend mit der dritten, vor allem aber in den beiden letzten
Etappen.
Ihre Kommentare zu diesem Aufsatz und vor allem Ihre Bitte an Herrn
Dr. Gündisch, das SibiWeb weiter mit so guten Beiträgen wie
diesem zu unterstützen senden Sie bitte per Fax an: +49 (441) 600 11
65.
Emails an das SibiWeb mit einem entsprechenden Hinweis werde ich
gerne per Fax an Herrn Dr. Gündisch weiterleiten!
Für Hinweise auf Rechtschreibefehler möchte ich mich bei
Georg Schuller aus Edmonton, Canada,
recht herzlich bedanken. Bei rumänischen Namen sind noch reichlich Fehler
vorhanden, weil der Konverter mit den rumänischen Sonderzeichen nicht
zurecht kommt.
Über Korrekturhinweise würde ich mich nach wie vor
freuen!

Abrufe seit dem
23.07.97 |
|
Dokument: ../geschi/siebsach.htm, zuletzt
editiert von Dirk Beckesch am
20.02.01